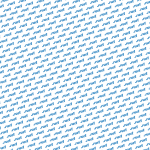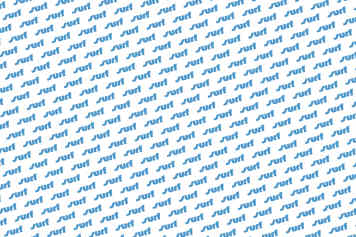Ich starre auf den schier unendlich scheinenden Eishang, der vor uns aufragt, und frage mich, ob ich ein gutes oder schlechtes Gefühl dabei habe. Antwort: Ich habe gar kein Gefühl. Während wir Achterknoten in unsere Gurte knüpfen, wandert meine Hand immer wieder zu dem kleinen braunen Spielzeugpferd meines Neffen, das ich als Glücksbringer in der Hosentasche trage. Ich bin es eigentlich gewohnt, Risiken abzuschätzen, besonders am Wasser. Aber ich habe keine Erfahrung mit den Risiken am Eis und diese Unsicherheit ist beängstigend. Wir sind sehr abgeschieden, an einem Ort, wo Gletscherspalten und -mühlen eine reale Gefahr darstellen – für Fehler ist hier kein Platz.
Als wir langsamen Schrittes mit dem Aufstieg beginnen, knirscht der Boden unter unseren Klettereisen. Ich stoppe auf dem Kamm des Hügels und betrachte die Landschaft, die sich vor mir ausbreitet: ein Plateau aus Weiß, aus Eis und Schnee, so weit das Auge reicht. Unermesslich, pur und mit nichts zu vergleichen, was ich bis jetzt gesehen habe.
Dann, ein atemberaubender Anblick. Wir halten an, wir sind wirklich hier – nach Jahren des Planens und Hoffens liegt der See vor uns, überwältigend in seiner azurfarbenen Beschaulichkeit und wie eine Erscheinung, die nur in diesem Moment und nur für uns zu existieren scheint.
450 Kilometer paddeln im ewigen Ei
Wir haben an diesem Tag bereits mehr als die Hälfte unseres Grönland-Abenteuers hinter uns, bei dem wir – ohne Hilfskonvoi – 450 Kilometer von Upernavik nach Kullorsuaq paddeln. Ziel ist es, unsere Entdeckungen entlang der Strecke zu dokumentieren, aber auch, die Eisdecke nach den legendären, schwer erreichbaren Eisseen abzusuchen und andere an unseren Erfahrungen teilhaben zu lassen.

Ich hatte bis zu diesem Trip nie zuvor auf eine persönliche Anzeige geantwortet und erst recht nicht auf eine von drei Fotografen, die auf der Suche nach einer weiblichen Begleitung waren – für eine einen Monat dauernde Exkursion im ewigen Eis in einem unwirtlichen Land. Die drei Herren hatten drei Jahre lang an den Vorbereitungen für diesen Trip gearbeitet. 2021, nur fünf Tage vor der geplanten Abreise, wurden ihre Flüge aufgrund von Covid gestrichen. Justin und Jean-Luc sind Mitglieder des Fotografen-Kollektivs PlanetVisible, das es sich zum Ziel gesetzt hat, abgelegene Orte zu entdecken, zu dokumentieren und ihre Erfahrungen mit der Öffentlichkeit zu teilen. Für sie beide war Grönland ein lang gehegter Traum, der eine ganze Zeit lang realistisch und greifbar nahe war. Der Dritte im Bunde ist Pascal Richard, ebenfalls Fotograf und ein langjähriger Freund der beiden.
Ich hatte nicht wirklich daran geglaubt, eine Chance auf diese Reise zu haben, doch im März wurde ich tatsächlich ausgewählt, als Journalistin das Team zu komplettieren. Schon im Mai hatten wir dann unser erstes persönliches Treffen, ein Wochenende, das wir mit Paddeln und einem Gletscher-Sicherheitstraining verbrachten. Im Juli war es dann so weit und wir warteten am Flughafen Kopenhagen auf den zweiten von insgesamt vier Flügen, die uns an unseren Ausgangspunkt für das SUP-Abenteuer bringen sollten.
Grönland ist sehr dünn besiedelt
Grönland, die größte Insel der Welt, ist mit 2,16 Millionen Quadratkilometern etwa sechsmal so groß wie Deutschland und hat gerade einmal 56.000 Einwohner. Es gibt keine Straßen oder Eisenbahnen, stattdessen fahren hier Hundeschlitten, Kajaks, Schneemobile und Fischerboote, und der Eisbär hat nach wie vor uneingeschränkte Herrschaft. Es ist schon interessant, wie man innerhalb von 24 Stunden von einer heißen Dusche in einer kosmopolitischen Hauptstadt in einen winzigen Kiosk am 72. Längengrad geraten kann und sich in einer Diskussion mit drei bis vor Kurzem Unbekannten wiederfindet, bei der sich alles um den Kauf des richtigen Gewehrs dreht.

Wir machen uns ohne Zwischenfälle auf den Weg, ausgestattet mit unseren SUPs, die neben dem soeben erstandenen Gewehr auch unser gesamtes Gepäck transportieren müssen, das mehr als 230 Kilogramm wiegt. Die ersten 14 Tage auf unserem Weg Richtung Norden navigieren wir durch das beinahe unbewohnte Archipel von Upernavik, wo wir auch wild campen. Das Beladen und Entladen der Boards dauert länger als angenommen, doch es stellt sich recht schnell eine Routine ein. An einem Abend zu Beginn unseres Trips veranstalten wir eine Trainingseinheit mit dem Gewehr. BÄNG! Wir zielen und schießen auf einen Eisberg. Das macht zwar Spaß, zugleich ist die Vorstellung, einem Eisbär auf dem Eis oder gar im Wasser zu begegnen, auch beunruhigend. Hätten wir überhaupt genug Zeit, um das Gewehr aus seiner Tasche zu holen? Auch wenn Begegnungen solcher Art um diese Jahreszeit eher unwahrscheinlich sind, kommen sie vor – immerhin unterliegt die Landschaft stetigen Veränderungen und der natürliche Lebensraum der Eisbären wird immer kleiner.

Wir paddeln zügig voran und machen nur halt, um uns vor den aggressiven Winden mit 30 Knoten zu verstecken. So legen wir Tag für Tag in sieben bis zehn Stunden eine Strecke von 20 bis 30 Kilometern zurück und rasten nur, um Fotos zu machen (die Jungs) und um zu essen (meistens ich). Wir erleben eine starke Kameradschaft und ich knüpfe mit jedem der drei eine besondere Beziehung. Die Bedingungen können ganz schön herausfordernd sein, die Wassertemperatur liegt gerade einmal über null Grad – da möchte man nicht hineinfallen. Selbst eine kleine Verletzung könnte hier draußen schwerwiegende Folgen haben.
Der Wind ist unberechenbar
Der Wind zeigt sich unberechenbar und immer weniger oft auf unserer Seite. Das Paddeln ist manchmal ein wahrer Kampf. Ich werde nie vergessen, wie wir an unserem allerersten Nachmittag bei der Umrundung von Upernavik drei Stunden lang gegen aggressiven Gegenwind ankämpfen mussten, in Gewässern, die sich zäh und dickflüssig wie Sirup anfühlten. Während ich mein Paddel mit aller Kraft in die raue, blaugraue See stieß und mit möglichst breitem Schritt versuchte, das Gleichgewicht zu halten, habe ich geflucht und mich gefragt, wie um alles in der Welt ich einen ganzen Monat dieser Art überstehen sollte. Tatsächlich habe ich mich gefragt, warum ich überhaupt auf einem Paddelboard stand und warum ich mir diesen Irrsinn antat – nur um mich besser zu fühlen? Frisch gefangener Kabeljau zum Abendessen, gefolgt von herrlicher Nachtruhe unter der Mitternachtssonne – da sind diese Gedanken aber bald vertrieben, sodass ich am nächsten Morgen bereit für eine neue Runde Abenteuer war. Die Weite und Wildheit, der wir uns gegenübersehen, ist kaum zu ignorieren und es ist schwer, das nicht zu genießen.

Denn die Gegend, in der wir uns befinden, wirkt beinahe außerirdisch und so, als sei sie einem Stück von Tolkien entsprungen. Das Eis spielt die Hauptrolle und jeder Tag versetzt uns mit ständig neuen gefrorenen Formen in Staunen. Verfallene Türme und krumme Speere erheben sich aus den dunkelblauen Tiefen und lassen uns ganz klein erscheinen. Riesige Eisflächen, größer als ein Sportstadion, umgeben uns. Zwischen ihnen zu paddeln, fühlt sich zunehmend wie eine Runde „Ochs am Berg“ an – man möchte nah genug kommen, um das schiere Ausmaß und die Proportionen aus nächster Nähe zu inspizieren, aber zugleich genügend Abstand halten, um die Folgen eines plötzlichen, von Donnergrollen begleiteten Niedergangs nicht hautnah zu spüren zu bekommen.
Eisberge erscheinen lebendig durch die Geräusche
Für mich sind die Geräusche, die die Eisformationen von sich geben, unvergesslich: Sie atmen, sie tropfen, sie gähnen und stöhnen. Das dröhnende, donnergleiche Grollen, das zwischen den einzelnen Landmassen widerhallt, erinnert uns daran, dass die größten Formwandler der Natur gerade in nächster Nähe kollabieren. Ein abgehacktes Knacken kündigt in der Regel das Abbrechen eines mächtigen Eisstücks an, das eine meterhohe Welle verursacht, die sich zum Glück ebenso schnell wieder zurückzieht, wie sie aufgekommen ist. Wenn das passiert, dann knistern die Geröllsplitter wie Reiscrispies. Unberechenbare Biester, die torkeln und taumeln, die sich in Sekundenschnelle drehen.

Nicht alle Eisberge entlang unserer Route gleichen jedoch grimmigen Giganten. Wir passieren auch eine Reihe von Fjorden, die sieben und mehr Kilometer breit und voll von geborstenem Eis sowie massiven Klumpen jeder erdenklichen Form und Größe sind. Durch sie müssen wir unseren Weg bahnen, um auf die andere Seite zu gelangen, und dabei ständig aufpassen, dass wir jenen Eisbrocken, die aussehen, als würden sie jeden Moment umfallen oder ins Wasser kippen, ausweichen. Auf solchen Strecken nehmen die Eisbären-Witze zu, während wir nervös die Umgebung nach möglichen Spuren absuchen.
Der Eissee hoch über dem Meer
Und nun stehen wir 600 Meter über dem Meeresspiegel an den Ufern eines Eissees, voller Ehrfurcht, Begeisterung und Staunen. Das ist die andere Hälfte des Traums: die Eisfläche zu erklimmen und einen der großteils unbekannten Schmelzwasserseen zu entdecken. Sie entstehen im Sommer auf der Eisoberfläche und erreichen Durchmesser von mehreren Kilometern sowie Tiefen von mehreren Metern. Ihr Entstehen ist abhängig von Temperatur, Topografie und Höhe und sie können monatelang Unmengen von Süßwasser speichern, das jedoch innerhalb weniger Stunden abfließen und verschwinden kann. Ihr vermehrtes Auftreten ist – wenig überraschend – auf den fortschreitenden Klimawandel zurückzuführen.
Der See, der sich vor uns im Schnee ausbreitet, wird nur von einem kleinen Rinnsal gespeist, das sich den Weg vom Ufer durch die Tiefen des Wassers bahnt, um einen Abfluss ins Meer zu finden. Wir stehen in sicherer Entfernung des Gewässers und analysieren eine runde Form, die wie eine ominöse, blaue Sprechblase in seiner Mitte zu sitzen scheint.
„Wer wagt sich aufs Wasser?“, fragt Jean-Luc zögernd.
„Ich“, sage ich.
Die Antwort kam instinktiv. Wir waren diesen ganzen weiten Weg gekommen, waren stundenlang über Felsen und Eis geklettert, um hier anzukommen. Es war ihr Traum. Ich bin keine Fotografin, daher macht es Sinn, dass ich mich hinauswage, sodass sie jemanden haben, den sie in ihren Bildern einfangen können. Also marschiere ich mit meinem Board auf den Seen zu und versinke mit jedem Riesenschritt mehr in Matsch und Eis, manchmal bis zu den Oberschenkeln. Dabei behalte ich das merkwürdige kobaltblaue Bullauge, das wie ein höhlenartiger Krater wirkt, stets im Auge.
Ich erreiche das Ufer, klettere wie ferngesteuert auf das Board und stoße mich ab. Langsam ziehe ich mein Paddel durch das ruhige Wasser unter mir. Die Sonne bricht durch die Wolken und ich spüre, wie die Energie mich elektrisiert. Ich fühle mich wie die glücklichste Person auf dem Planeten und erlebe einen besonders spirituellen Moment. Es ist einer dieser Momente, von denen ich weiß, dass sie mein Leben formen werden.

Wir machen uns jubilierend an den Abstieg.
Das Terrain ist fordernd – unter anderem müssen wir einen Fluss durchqueren und über mehrere Felsen klettern. Dabei spüren wir durchnässtes Moos und lose Steine unter unseren Füßen. Es ist ein konstanter Kampf, der unsere ganze Aufmerksamkeit erfordert, wenn wir nicht ausrutschen, den Halt verlieren, hinfallen oder uns die Knöchel verstauchen wollen. Ich kann es kaum erwarten, wieder auf dem Board zu stehen.
Lebensnotwendige Routine
Die letzte Woche führt uns gen Norden, durch noch mehr Eis und entlang felsiger Inseln, die unter zunehmend mehr Schnee versinken und stetig steiler werden. Unsere Tage sind von einer gewissen Routine geprägt: Wir frühstücken, packen das Camp zusammen, zwängen uns in unsere bananengelben Trockenanzüge und durchnässten Stiefel, füllen unsere Wasserflaschen und Snackbeutel, beladen die Boards und sichern alles, bevor wir uns auf einen weiteren spektakulären Tag ins Ungewisse aufmachen.
Unser Weg wird zweimal von enormen Massen Packeis blockiert, sodass wir unsere Route ändern und um mehrere Halbinseln herum paddeln müssen. Dadurch machen wir nicht nur zusätzliche Kilometer, wir sind auf einer Seite auch dem offenen Meer ausgesetzt. Die Landschaft, eine Mischung aus mit Flechten bewachsenen Felsen und schneebedeckten Gipfeln, ist karg und unerbittlich. Es ist unmöglich, sich von der Abgeschiedenheit, in der wir uns befinden, nicht einschüchtern zu lassen.

Leider sehen wir keine Wale. Was wir sehen (und hin und wieder aufschrecken), sind zahlreiche Enten mit ihren Jungen. Wir sehen jede Menge Vögel, inklusive des Nordatlantischen Eissturmvogels, und gegen Ende unserer Reise auch Küstenseeschwalben. Wie sie zwischen und um uns ihre Bahnen ziehen und immer wieder abtauchen, erinnern sie an große, weiße Schwalben. Ganz besonders einprägsam war für mich die Begegnung mit einer schlafenden Robbe. Jean-Luc und ich paddelten zu ihr hin und dachten, sie sei tot, bis wir ein paar Blasen aufsteigen sahen. Die Robbe sah uns erschrocken und mit großen Augen an, bevor sie blitzschnell und mit einer dramatischen Geste in die sicheren Tiefen des Wassers entschwand.
Englisch lernen per YouTube
Die einzigen Menschen, denen wir auf dem Wasser begegnen, sind Fischer auf der Suche nach Robben oder Heilbutt. Während Erstere mit dem Gewehr erlegt werden, fangen die Grönländer Letztere mit einer Angelschnur, die bis zu 500 Meter lang sein kann. Zu Beginn unseres Trips trafen wir auf einige junge Fischer aus Nuussuaq, einem kleinen Ort mit weniger als 200 Einwohnern, den wir nach 20 Tagen auf dem Wasser besuchen würden. Beeindruckt von ihren Englischkenntnissen in einem Land, wo dies nicht die Amtssprache ist, fragten wir, wo sie es gelernt hätten.
„Von YouTube und aus Filmen“, „Ich liebe ‚Dark Knight‘“. Erstaunlich, wie sehr das Internet die Welt verändert hat und nach wie vor verändert.
Grönland ist ein Land der Extreme
Wir paddeln nach Kullorsuaq, mit gedämpfter Stimmung und doch froh anzukommen. Die nördlichste Niederlassung des Upernavik-Archipels wurde 1928 gegründet und ist mit rund 450 Einwohnern bis heute eine der ursprünglichsten Jäger- und Fischergemeinden Grönlands. Während wir am Heliport auf unseren Hubschrauber nach Upernavik warten, heißt es, dieser komme nicht mehr. Später erfahren wir vom Piloten, dass er nur zehn Kilometer entfernt war, aber dicker Nebel eine Landung unmöglich machte. Deshalb sitzen wir weitere vier Tage fest, bevor wir unsere Heimreise antreten können, und wissen dabei nie, wann es so weit sein wird – eine echte Geduldsprobe für jeden Einzelnen von uns. Für mich außerdem eine Lektion in Sachen Kontrolle, die mir aufzeigt, wie sehr wir uns daran gewöhnt haben, Kontrolle über unser tägliches Leben zu haben. Doch hier hat die Natur das Sagen: Die Landschaft und Naturgewalten bestimmen das Leben und der Mensch ist klein und unbedeutend.
Grönland ist ein Land der Extreme. Es herrscht entweder monatelang Tageslicht oder Dunkelheit.
Das größte Paradoxon ist für mich, dass das, was dich umbringen könnte, dich auch am Leben hält. Umgebungen wie diese schärfen unsere Synapsen.
Eis, Schnee und extreme Kälte bestimmen den Alltag. Das größte Paradoxon ist für mich, dass das, was dich umbringen könnte, dich auch am Leben hält. Umgebungen wie diese schärfen unsere Synapsen. Sie erinnern uns daran, dass unser Verstand so konditioniert ist, dass er uns zu überleben hilft. Hier draußen müssen jeden Tag Risiken gegen den möglichen Ertrag abgewogen werden. Die feindselige Landschaft erfordert Wachsamkeit und hält das innere Feuer am Lodern. Sie macht süchtig nach mehr und ist ein Grund, die eigene Komfortzone zu verlassen und jenen Nervenkitzel zu erleben, der nur durch extreme Bedingungen möglich wird.
Dabei lernen wir, uns im Unbehagen behaglich zu fühlen.
Und das ist der Grund, weshalb ich auf die Anzeige geantwortet hatte, weshalb ich einen Trip wie diesen brauchte: um mir das Gefühl zu erlauben, dass meine Energie vollständig gefordert und aufgebraucht wird. Um den tosenden Lärm des täglichen Lebens zur Ruhe zu bringen, um absolute Stille zu finden, um ungewollte Geräusche abzuschalten. Zu Beginn unserer Reise erwähnte Jean-Luc ein Sprichwort, das sein Vater immer wieder zitiert hat: „Es ist besser zu wissen, wo du bist, ohne zu wissen, wohin du gehst, als zu wissen, wohin du gehst, ohne zu wissen, wo du bist.“