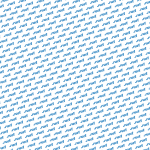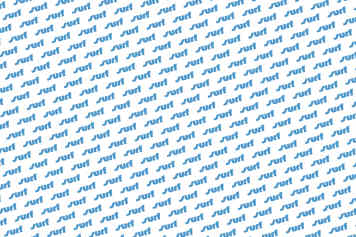Freerideboards: Board-Evolution - wie schlagen sich Oldtimer und Youngtimer gegen moderne Boards?
Stephan Gölnitz
· 14.10.2025






“Auf jeden Fall surfen wir zuerst den Horst!“ Darin sind wir sofort einig. Aus dem Sammelsurium von neuen und historischen Shapes, die wir zum Neusiedlersee gekarrt hatten, hat der weiße Sputnik 280 einen magischen Reiz. „Horst“, hat irgendwer vor langer Zeit liebevoll mit Filzstift neben der Mastspur signiert. Ob es nach dem glücklosen Galopp-Renner Horst aus „Bang Boom Bang“ von 1999 benannt wurde oder ob der ehemalige Besitzer so hieß, ist unbekannt. Das Board hat jedenfalls bereits ein Jahrzehnt Gnadenbrot in der Mitnahmetonne vor einem Surfshop hinter sich sowie eine kurze, aber erfolgreiche Karriere als Kinder-Race-SUP in den 2010er-Jahren.
Freerideboards: 1997 bis heute
Jetzt darf der 90er-Jahre-Shape sich noch ein letztes Mal in seinem angestammten Lebensraum austoben. Franky schnappt sich den rassigen Renner zuerst. Beim Angleitversuch vor der Illmitzer Promenade stellt sich das Board im Wasser steil auf wie die Skischanze in Innsbruck, Franky verschwindet bis zu den Knien im Neusiedlersumpf, nur die Boardspitze schaut heraus wie die letzten Zentimeter der „Titanic“. Wie können 105 Liter bloß so wenig Auftrieb haben? Das Gesetz von Archimedes scheint für Boards mit superschmalem Heck nicht zu gelten. Keine zehn Minuten später kommt der Tester dennoch euphorisch vom Wasser zurück: „Ich bin gerade die schnellste Halse meines Lebens gefahren! Aber das Ding ist anspruchsvoller als mein 70-Liter-Waveboard.“ Die 105 Liter Volumen sind auf 2,80 Meter Länge und 54 Zentimeter Breite verteilt, was den idealen Proportionen eines nordischen Fichtenstammes näher kommt als denen eines alltagstauglichen Windsurfboards. Wir haben Frankys Super-Halse nicht gesehen, das Kabbelwasser-Rodeo umso besser.
Der Sputnik 280 ist wackeliger als mein 70-Liter-Waveboard.”
Zu Besuch bei Shape-Legende Werner Gnigler
Einen Tag zuvor hatten wir Werner Gnigler besucht. Er shapt die aktuellen JP-Boards, und in seinem Büro stehen noch die vergilbten Ordner mit allen Shape-Daten der F2-Palette bis weit zurück in die Neunziger. „Damals ging es vor allem um Speed“, erinnert sich Werner beim Durchblättern. „Worldcup-Profis wie Bjørn hatten zu jedem Racesegel mindestens ein Board und haben versucht, immer das schmalste zu fahren. Um überhaupt eine Chance zu haben, darauf ins Gleiten zu kommen, mussten die Boards zum Ausgleich – nach dem Motto ‚Länge läuft‘ – entsprechend lang sein.
Diese Shape-Philosophie wurde auch auf die Freerideboards übertragen. Den Freeride-Vertreter der späten Neunziger, den kanariengelben F2 Ride 282, bitten wir also zur Vergleichsfahrt gegen den aktuellen Magic Ride. Der Ride ist satte 14 Zentimeter schmaler und unendlich wirken- de 40 Zentimeter länger. „Die Nasenaufbiegung war ja Wahnsinn“, hatte Werner tags zuvor amüsiert festgestellt. „Der alte Ride hat ja 30 Zentimeter Scoop. Heute liegen Freerideboards knapp über 20 Zentimeter.“ Die alten Klassiker, wie unser Ride 282 oder auch die Xantos-Serie, surften dazu auf geraden Gleitflächen von einem Meter oder sogar 1,10 Meter Länge, heute sind 80 Zentimeter Freeride-Standard. Nur über eine große Gesamtlänge war damals ein flacher Angleitwinkel von der Gleitfläche bis hin zu den 30 Zentimeter Aufbiegung am Bug möglich.
Auf dem Wasser spüren wir nach dem extrem wackeligen Losdümpeln, was manche Surfer in der vielleicht etwas verwässerten Erinnerung an den alten Boards so schätzten. Zum einen tuckert der lange Ride im Nichtgleiten recht flott los und läuft dann zumindest mit der Nase so hoch übers Wasser wie kein aktuelles Board. Der spitze Bug spießt eher eine tief fliegende Möwe auf, als in eine Kabbelwelle zu stechen – was zu den Urängsten vieler Surfer zählt. Beim ersten Vergleichs-Run ist ordentlich Wind mit richtig Zug auf der Gabel. Da gleitet der Ride mit dem neuesten Magic Ride nahezu gleichauf an. Beide beschleunigen flott, und auf tiefen Raumkursen malen wir zwei Schaumstreifen auf den trüben See, so synchron wie im Formationsflug. Der Ride erfordert dabei viel Körperspannung, will sauber auf die Leekante gekippt und dort stabil fixiert werden. Das ist kein Cockpit für Beinchen mit unterdimensionierter Schienbeinmuskulatur. Bei seitlichen Wellen rollt das Board leicht mit – aber alles in allem rast der gelbe Torpedo mit wenig Widerstand und sehr gutem Topspeed über den See. Waren 25 Jahre Entwicklung für die Tonne?
Schnell, aber nur mit viel Einsatz
„Im Topspeed waren die alten Boards schon richtig schnell“, hatte Werner Gnigler uns vorgewarnt, „aber für den Hobbysurfer ist die Durchschnittsgeschwindigkeit viel wichtiger und wie einfach die rauszuholen ist.“ Der zweite Testlauf bei weniger Wind lässt den immer noch frisch leuchtenden Ride, den wir neuwertig aus der Deko vom „Surftools“-Shop gezogen hatten, tatsächlich ziemlich alt aussehen. Der Wind schwankt zwischen mittlerem und unterem Gleitbereich, der Magic Ride legt sich nach dem Angleiten fast schon stoisch im idealen Gleitwinkel aufs Wasser, erlaubt, viel Druck auf die Finne zu geben, und schlägt mit dem Bug nicht stärker aus als der Tonabnehmer in einer „Kuschelrock“-LP. Der Ride dagegen macht ohne solide Körperspannung, was er will: Der Bug schlägt rauf und runter, die lange Gleitfläche schlägt krachend in die kurze Kabbelwelle, obwohl die spitze Nase in den Himmel zeigt wie eine Ariane 6 auf ESA-Mission.

Dem alten Ride fehlt im mittleren Windbereich einfach der eigenständige Lift. Der Grund liegt im starken V im hinteren Gleitbereich. „Du darfst beim V nicht nur aufs Lineal an der Seite schauen, sondern musst den Winkel vergleichen.“ Werner Gnigler zeigt den häufig gemachten Fehler bei der Begutachtung: „Wenn ich bei einem 20 Zentimeter breiteren Board den gleichen Wert an der Seite messe wie bei dem schmalen Board, ist der Winkel ja viel flacher. Die alten Freerideboards hatten 1,5 bis 2 Zentimeter an der Kante, obwohl sie so schmal waren. Das hat man gemacht, um die Boards besser aufzukanten und für Kontrolle. Damit liegt ein Board aber auch satter im Wasser.“
Auftrieb durch ein flaches Unterwasserschiff
Aktuelle Boards haben unter der Mastspur zwar oft noch ein dämpfendes V oder eine ebenfalls absorbierende Konkave, unter den Schlaufen wirkt der Shape dagegen meist eher unspektakulär – denn ein flaches Unterwasserschiff gibt den meisten Auftrieb. „Im Gleitbereich wollen wir extrem viel Lift, damit das Board eine freie Gleitlage bekommt“, liefert Werner die Erklärung. Und das funktioniert im Praxistest tadellos: Während sich der alte F2 Ride nur mit dem vorderen Schienbeinmuskel unter Hochspannung auf die Leekante und in eine freie Gleitlage pressen lässt, „hoovert“ der Ride – so wie viele moderne Boards – auf dem breiten, nahezu planen Heck selbst dann noch hoch und frei durch Windlöcher, wenn der Fahrer lediglich tiefenentspannt an der Gabel hängt. Deshalb und für eine hohe Eigenstabilität und beste Gleiteigenschaften wurden die Boards bis vor acht oder zehn Jahren immer breiter. Einige sind dabei zwischenzeitlich auch zu sehr „auseinandergegangen“.
Der AHD 117, etwa Modell 2010, vertritt die Zwischengeneration in diesem Test. 2,50 Meter lang und 67,5 Zentimeter breit. Damit wirkt das Board beim Lostuckern wackeliger als der neue Magic Ride, aber nicht mehr so „oldschool“ wie der gelbe Ride. Die Nose ist bereits breiter, die Gleitlage immer noch etwas tiefer und satter, aber der Bug eher moderat aufgebogen und dadurch irgendwie „gewohnter“. Mit identischen Finnen surft der AHD dem Magic Ride durchweg hinterher. Die sattere Wasserlage – auch hier fehlt noch dynamischer Eigenauftrieb im Heck – wirkt komfortabel und gedämpft, kostet aber Fahrleistung in allen Gängen.
Viel mehr als die Leistungseinbußen stören die wabbeligen Schlaufen und die überstreckten Fußgelenke. Die Pads sind unter den Fersen besonders dick. Das macht man heute so nicht mehr. Der AHD ist der surfende Youngtimer in diesem Test. So ein Board geht als „Daily Driver“ durchaus noch durch. Den gleichen Komfort und die Leistung eines aktuellen Boards sollte man aber nicht erwarten.
Einige Shapes sind übers Ziel hinausgeschossen
Das sollte der orange 2015er Magic Ride besser können. Die letzten drei Generationen Magic Rides hatten die Maße 239/76, 240/75 und 241/74. Die Ära der maximal breiten Boards ist seitdem überschritten. „Jeder Trend schießt einmal über das Ziel hinaus“, rechtfertig Werner den Schritt zurück. „Mit den ersten deutlich breiteren Boards haben wir schnell die Vorteile erkannt. Dann entstand ein richtiger Hype, und erst etwas später hat man erkannt, dass die ganz kurzen Boards doch nicht so toll angleiten.“ In unserem Test schlägt sich die vorletzte Generation des Magic Ride (240/75) aber recht gut gegen das aktuelle Board (241/74). Ein Unterschied im Fahrgefühl ist kaum zu spüren. Der neueste Shape gleitet mit gestreckterer Outline und überarbeitetem Kantenradius aber länger und stabiler durch die Halse.

Dafür ist das fortlaufende Feintuning in der Entwicklung – der sprichwörtliche letzte Schliff – verantwortlich. Wie etwa beim Rail Shape. „Heute schauen wir bei der Modellpflege mehr auf die Feinheiten“, sagt Werner, fährt mit dem Finger übers Rail und sucht den Punkt der größten Breite. „Der Apex Point beispielsweise, der Punkt, an dem die maximale Breite an der Kante ist. Wenn der zu tief ist, schwappt schon beim Angleiten Wasser übers Deck, das Board saugt sich fest, und auch in der Halse hast du weniger Auftrieb. Das Board bleibt dann früher stehen. Und auch wie das Wasser seitlich vom Rail wegspritzt, legt man mit dem Kantenshape fest. An solchen Dingen arbeiten wir immer weiter.“ Tatsächlich haben in surf-Tests die besonders breiten Boards mit runder Outline und besonders dünnen Rails oft weniger gut bei weiten, sportlichen Gleithalsen abgeschnitten. „Der Auftrieb war bei den Boards mit runder Outline und einem schmalen Heck in der Halse nicht ausgewogen“, erklärt Werner. „Wenn Heck- und Mittelbreite etwas ausgeglichener sind, kann ich in der Halse viel leichter den Speed halten.“
Breite Boards mit hohem Eigenauftrieb fahren sich einfach entspannter. Auf langer Strecke genauso wie in der Halse.”
Beim Einladen der alten Flotte muss ich auch wehmütig an meinen geliebten, schon lange verschrotteten Hanomag-Bus Baujahr 1977 denken. Doch nach einer Millisekunde, versunken in 60-PS-Romantik, weiß ich – so wie nach diesem Boardtest – wieder ganz genau: Die lange Rückfahrt vom Neusiedlersee wird im komfortablen Redaktions-Bulli unendlich angenehmer sein.
Alte gegen neue Boards - das surf-Fazit
- Falls dich bei starkem Wind tatsächlich mal so eine alte Banane überholt: Ärgere dich nicht, die Boards waren – mit viel Druck im Segel – auch damals schon schnell. Aber im nächsten Windloch, bei idealem Gleitwind, im Schnitt über lange Distanz und spätestens in der Halse bieten aktuelle Boards spürbar mehr Leistung, Sicherheit und Komfort.
- Freerideboards über 2,60 Meter Länge oder unter 65 Zentimeter Breite (bei Boards über 110 Liter Volumen) sind auch für null Euro bei Kleinanzeigen kein „Geschenk“ – du übernimmst eigentlich nur die Entsorgung oder erschwerst dir deine Surfkarriere mehr als unnötig.
- Freerideboards der letzten zehn Jahre kannst du nahezu bedenkenlos kaufen.