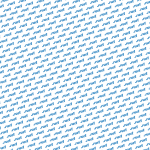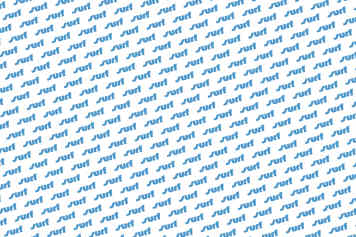Board-Entwicklung: Oldtimer, Youngtimer und aktuelle Freestyle-Boards im Vergleich
Julian Wiemar
· 05.10.2024






- Diese Freestyle-Boards waren im Vergleich dabei
- Die Entwicklung der Freestyle-Boards
- Wie geeignet sind moderne Freestyle-Boards für Durchschnitts-Surfer?
- Kontrollierbarkeit und Sicherheit durch Länge
- Drehfreudigkeit durch Kompaktheit
- Gleiten, Carven & Speed
- Pop & Airtime
- Kurze Finnen: Wenige Zentimeter, großer Unterschied
- Die aktuellen Freestyleboards im Vergleich
- Typenempfehlung Freestyleboards
Freestyle, der freie Stil. Mach, wonach dir ist – ganz ohne Vorgaben oder Einschränkungen – frei wie der Wind. Tob dich auf dem Wasser aus, denn nichts ist falsch, nichts ist richtig. Manöver kommen, Manöver gehen. Die modernen Rotationen werden höher, schneller, doppelt oder dreifach gesprungen, doch auch alte Tricks leben wieder auf, werden mit aktuellen kombiniert und es entsteht ständig etwas Neues.
Keine Windsurfdisziplin ist so sehr im Wandel wie die des freien Stils. Anlass genug, sich einmal grob in die Vergangenheit und wieder zurück zu tricksen. Mit zwei exemplarischen Oldtimer-Boards aus den frühen 2000ern, einem Youngtimer Baujahr 2013 und vier der brandaktuellsten, radikalsten Freestyleboards aus der Saison 2024 im Gepäck zogen wir in diesem wellenarmen Sommer mit ein paar grundlegenden Freestyle-Fragen im Kopf los. Nun, wo die Tage wieder kürzer werden, Tiefdruckgebiete die Nordsee wieder zum Brodeln bringen und der Wave-Test vor der Tür steht, sind wir mit vielen Erfahrungen und spannenden Erkenntnissen wieder da – die wir euch natürlich keinesfalls vorenthalten wollen. Doch vorab ein kurzer Blick in die Vergangenheit.
Diese Freestyle-Boards waren im Vergleich dabei






Die Entwicklung der Freestyle-Boards
Ganz so frei wie der Wind waren sie (noch) nicht, die Pros der Neunziger, bevor Freestyle überhaupt aufkam. Auch sie hatten Verpflichtungen abseits des Surfens, wie beispielsweise die Anwesenheit bei Festivals oder Händler-Meetings an europäischen Flachwasserrevieren wie dem Gardasee. Und genau während dieser Veranstaltungen entstand Freestyle im Prinzip aus einer Notsituation heraus, denn die Jungs aus Hawaii wie Robby Seeger, Jason Polakow oder Josh Stone vermissten im Gegensatz zu ihren Racing-Kollegen die Wellen, um ihren Fans vor Ort eine Show auf dem Wasser bieten zu können und die Bretter ihrer Sponsoren in Szene setzen zu können. Kurz gesagt: Sie langweilten sich. Also schnappten sie sich einfach ihr großes Wave-Zeug und fingen an, Loops und Kreisel auf Flachwasser direkt vor dem Publikum zu drehen. Die Leute am Ufer drehten durch – Freestyle war geboren.
Doch wann war sie, die goldene Zeit des Freestyles? Gute Frage. Waren es die frühen 2000er, als aus den zu Beginn verwendeten Waveboards langsam Freestyleboards wurden, die Disziplin sich Schritt für Schritt etablierte, jedoch für die meisten noch etwas ganz Neues und Besonderes war? Die Preisgelder waren hoch, die Profi-Teams der Marken im Vergleich zu heute riesig, der Freestyler plötzlich eines der meistverkauften Bretter bei mancher Marke – die Manöver auf dem Wasser aus heutiger Sicht jedoch vergleichsweise simpel, gar unspektakulär. Es mag absurd klingen, doch die Moves, mit denen sich Profis wie Josh Stone bei Contests wie dem prestigeträchtigen King of the Lake zu Stars tricksten und zugleich ihren Lebensunterhalt bestritten, springt heute jeder ambitionierte Hobbyfreestyler während der Feierabendsession.
Von der Massenbewegung zur Nischen-Disziplin
Doch Josh Stone war seiner Zeit mit der Rotation des Spocks einfach voraus und revolutionierte damit zur richtigen Zeit am richtigen Ort die gesamte Disziplin. Schaut man heute den Freestyle World Cup auf Fuerte, bekommt man immer noch in fast jedem Heat Spocks zu sehen, bloß mit dem feinen Unterschied, dass dieser mit einem Culo oder teilweise sogar einem fetten Kabikuchi kombiniert wird. „Spock into …“ heißt es dann. Das sind sehr elegante Move-Kombinationen. Die Tricks sind abgesehen von den verrückten Kombos zudem höher, verdrehter und explosiver geworden. Nach Carven und so viel Sliding wie möglich war irgendwann hauptsächlich Airtime in Form von Power Moves angesagt.
Die Bretter entwickelten sich zu kurzen, rotationsfreudigen Flugobjekten, die eher einem Skateboard ähneln.
Was das Level auf dem Wasser angeht, befinden wir uns fraglos gerade in der goldenen Zeit des Freestyles: doppelte Air-Rotationen, Shiftys, vierfache Spocks. Wer hätte das damals für möglich gehalten? Im Vergleich zu den Zeiten des King of the Lakes steht Freestyle heute in einer anderen Dimension, jedoch auch in einer deutlich komplizierteren, einer Nische, in die nur noch wenige den Einstieg zu finden scheinen und deren Komplexität das Ganze für den Laien am Ufer teilweise schwer nachvollziehbar macht. Die Bretter wurden im Jahresrhythmus an den neuen Stil der Nische angepasst. Die Shapes wurden immer radikaler. Sprich, zu kurzen, rotationsfreudigen Flugobjekten, die mittlerweile kaum noch die Form eines Surfbretts, sondern eher die eines Skateboards aufweisen.

Wie geeignet sind moderne Freestyle-Boards für Durchschnitts-Surfer?
Die Frage, die wir uns innerhalb des Testteams stellten: Wen bedienen die Marken mit diesen radikalen Shapes heutzutage? Wie benutzerfreundlich und alltagstauglich sind sie? Denn nicht jeder Freestyler hat als Lernziel den Double Air Culo auf dem Zettel stehen. Was ist mit denen, die es etwas entspannter angehen und Flaka, Spock und den einen oder anderen 360er, mit dem Josh Stone damals das Publikum verzauberte, drehen möchten? Müssen diejenigen vielleicht tatsächlich zu Boards greifen, die aus der Zeit stammen, als diese Moves in waren, oder können die modernen Boards das auch? Und nicht zu vergessen die spaßigste Aufgabenstellung: Was kann man aus den Oldtimern heutzutage so rauskitzeln?
Kontrollierbarkeit und Sicherheit durch Länge
Dass Länge läuft, hätte sich bei den Freestyleboards kaum deutlicher bestätigen können. Man hört es immer wieder und alle Tester konnten dem auch zustimmen. Es ist manchmal kaum zu glauben, was ein paar wenige Zentimeter Länge an Laufruhe geben und damit auch an Sicherheit im allgemeinen Fahrgefühl vermitteln können – besonders, wenn das Wasser kabbelig wird. Je länger das Board, desto eher kann man sich bedenkenlos hinten reinhängen, durch Kabelwellen brettern und sich auf das nächste Manöver fokussieren. Das gilt generationsübergreifend. Dass die älteren Shapes dazu im Bug auch noch etwas aufgebogen sind und spitzer zusammenlaufen, macht diese noch mal einfacher zu bedienen: „Mein alter JP lässt auch entspanntes Heizen und Freeriden zu, finde ich. Der Neue war mir persönlich zu zappelig, ich mache ja eh keine Sprungmanöver“, berichtet Robbi, der den 2008er-JP zur Verfügung stellte und diesen selbst auch noch hauptsächlich fährt.
Gut angepowert auf Raumwindkurs Speed für einen durchgecarvten 360er, aber auch zum Beispiel einen Air Flaka oder Ponch über einen kleinen Wellenrücken zu holen, kann auf einem 2,10 Meter kurzen Board mit flacher, runder Nase und 20 Zentimeter Finne tatsächlich viel schneller zur Rutschpartie werden und verlangt dem Fahrer ganz schön viel Fahrkönnen in Form von Segelkontrolle und auch Zehenspitzengefühl an Deck ab. Bei den Oldtimern hingegen heißt es: reinhängen und dichthalten. Was sich in Bezug auf allgemeine Kontrolle ebenfalls als spannend herausstellte, ist, dass es auf den älteren Boards somit auch einfacher ist, das Segel zu ducken, da diese während des Durchtauchens wie auf Schienen geradeaus fahren und man sich vollkommen auf seine Griffe konzentrieren kann.
Drehfreudigkeit durch Kompaktheit
Kommen wir im Anschluss direkt zum größten Nachteil der gestreckteren Boards: Fast jeder Zentimeter, der Laufruhe und Sicherheit gibt, bringt gleichzeitig Einschränkungen in der allgemeinen Drehfreudigkeit mit sich, und das stärker als erwartet. Selbst Klassiker wie Flaka, Spock und Co., die Moves, für die die beiden ganz alten Bretter im Prinzip gebaut wurden, verlangen einem viel mehr Kraft und Technik ab als die kompakteren Boards. Besonders der Absprung und die ersten 180 Grad der Drehung – egal, in welche Richtung. Die Jungspunde unter den Testern hatten sich erdacht, dass die Oldies Manöver dieser Art besonders gut könnten, da sie über den langen Bug im Wasser einen schönen Drehpunkt bilden könnten und sie dann wie Josh Stone durch Spocks, bei denen das Heck einen Meter in der Luft ist, wirbeln würden. Fehlanzeige. Zu Beginn ging erst mal gar nichts und dann nur mit angepasster Technik und viel mehr Krafteinsatz.
Jeder Zentimeter Länge bringt Nachteile bei der Drehfreudigkeit
Auch der Abstand zwischen Mastspur und Fußschlaufen, der bei den Oldtimern im Vergleich riesig ist und unter anderem zu der guten Kontrollierbarkeit beiträgt, macht in Bezug auf Kompaktheit und Drehfreudigkeit viel aus: „Zu einer modernen Air-Rotation wie Burner oder Culo anzusetzen traut man sich hiermit nur, wenn man die Moves auf den kompakten Boards wie im Schlaf beherrscht. Sonst ist das viel zu riskant. Die Teile fühlen sich an wie richtige Tanker“, meint Gasttester Nils, der auf seinem Fanatic Skate von 2020 schöne Burner springt und gerade am Culo arbeitet.

Der F2 Chilli als goldene Mitte
Als wir gerade einen fetten Minuspunkt für die Oldtimer verbuchen wollten, warf Sascha Lange, langjähriger Freestyler und Personal Trainer, der immer noch gerne regelmäßig Sliding Moves aufs Parkett haut und den alten F2 Chilli ausprobiert hat, Folgendes ein: „Man muss aber schon sagen, dass das Teil im Vergleich zu den neuen Boards supergeschmeidig und schön rückwärts slidet. Das Board vermittelt nicht nur beim Geradeausfahren eine wahnsinnige Ruhe und Sicherheit, sondern auch in den Manövern – vorausgesetzt, man kriegt es einmal um 180 Grad gedreht.“
Stimmt, die auffällige Heckform des Chillis nannte man nicht ohne Grund „Spocktail“. Sliden können sie, bloß das Rotieren ist deutlich schwerfälliger. Die goldene Mitte zwischen Kontrollierbarkeit und befriedigenden Rotationseigenschaften bildete hier tatsächlich der goldene Youngtimer namens F2 Rodeo unter den Testboards. Es liegt mit 227 Zentimeter Länge genau in der Mitte, hat ein einen leicht aufgebogenen Bug und bereits weniger Abstand zwischen vorderen Schlaufen und Mastspur als die Oldies. Es bildet damit genau die Mitte zwischen den beiden Generationen und so surft es sich auch: Es kann alles ganz gut, aber nichts perfekt.
Gleiten, Carven & Speed
Dass man mit den alten, langen Brettern allgemein besser angleiten würde, konnten die meisten fortgeschrittenen Freestyler unter den Testern nicht bestätigen: „Ich sehe keinen Grund für mich, solch ein älteres Board zu fahren, auch nicht im Leichtwind“, meint Jan, der häufig auch bei weniger Wind mit großen Freestylesegeln surft, selbst einen Freestyler von JP aus dem Jahr 2023 fährt und aktuell an ersten Power Moves wie dem Shaka feilt. „Die kurzen Boards drehen beim Anfahren vielleicht mal eher in den Wind und wollen daher etwas aktiver gesteuert werden, während der alte, lange JP hingegen schnurgerade die Spur hält – aber früher ins Gleiten komme ich damit auch nicht“, berichtet der 39-jährige Windsurfenthusiast, der seit Jahren jedes Lüftchen nutzt, um an neuen Tricks zu feilen.
Die langen Boards mit entsprechend längerer gerader Gleitfläche im Unterwasserschiff kommen harmonischer und bei passiver Fahrweise auch etwas einfacher ins Gleiten, könnte man sagen, aber nicht unbedingt früher. Denn wer die kleine Gleitschwelle, die die kürzeren Boards aufweisen, durch aktive Fahrweise überwinden kann, rutscht mindestens genauso früh los und wird dann richtig schnell.
Die kleinen Boards sind schneller und leichtfüßiger
Die kleinen, kurzen Boards fühlen sich so leichtfüßig und spritzig an, dass es einem mit der richtigen Pumptechnik teilweise so vorkommt, als könne man sie beim Angleiten regelrecht aus dem Wasser hebeln und aktiv in die gewünschte Richtung schieben, um Fahrt aufzunehmen. Während man die Oldies einfach machen lassen muss und sich auf ihr Angleitpotenzial verlassen muss.
Sie sind zwar anspruchsvoller schnell zu fahren, aber die meisten aktuellen Freestyleboards gehen ab wie Schmidts Katze. Vor allem der alte F2 Chilli mit dem einzigartigen Design wirkte dagegen teilweise wie eine lahme Gurke. Starboard beispielsweise setzt beim neuen Ignite seit ein paar Jahren auf die schnelle, flache Slalom-Rockerlinie des iSonics. Wer doppelt und dreifach hintereinander abspringen möchte oder vorhat, sich zu hohen Skopus hinauszukatapultieren, der kommt um Speed nicht herum, und genau darauf sind die neuen Shapes ausgelegt. Doch auch der Youngtimer Rodeo hängt die Oldies bereits ab und konnte sogar mit der Generation Alpha mithalten. Beim reinen Durchgleiten hingegen ging der Punkt aber klar an die Urgesteine unter den Testboards, denn eine Halse oder Duck Jibe kriegt man auf diesen Boards vergleichsweise kaum abgewürgt. Auch die längeren Kanten, die aufgrund der großflächigeren Volumenverteilung zudem einfach dünner sind, schneiden sauberer und auch mit nicht idealer Fußbelastung angenehmer durchs Wasser.
Pop & Airtime
Während doppelte, extreme Rotationsmanöver über den Bug wie ein Double Culo auf den Oldies fast unmöglich schienen, funktionierten etwas simplere, aber dennoch hohe Airmoves wie weit gezogene Konos oder Spinloops erschreckend gut. Diese klappten auf Anhieb fast besser als die zu Beginn ausprobierten Basics wie Spock oder Flaka. Das dünne, reaktive Heck des alten JPs in Kombination mit der größeren Finne ließ sich über den hinteren Fuß sehr gut aus dem Flachwasser zu Loops abdrücken. Der F2 Chilli mochte Konos besonders gerne – ein Move, an den noch nicht zu denken war, als dieses Board im Jahr 2005 entwickelt wurde. Durch die 1-a-Kontrolle kann man sich darauf voll und ganz auf die Segelpower nach dem Duck konzentrieren und ohne Rücksicht auf Verluste abdrücken – das hat richtig Laune gemacht.
Der F2 Chilli mochte Konos besonders gerne – ein Move, an den noch nicht zu denken war, als dieses Board im Jahr 2005 entwickelt wurde.
Doppelt poppen können die alten, flachen Hecks jedoch ganz und gar nicht, denn sie sinken dabei einfach ab. Während die modernen Boards mit ihren dicken Hecks gefühlt nach jeder sauberen Landung weiter über die Wasseroberfläche titschen möchten, muss man hier auch schon mit dem Youngtimer, dem dazu auch etwas Volumen im Heck fehlt, Abstriche machen.

Kurze Finnen: Wenige Zentimeter, großer Unterschied
Die nicht so erfahrenen Freestyler unter den Testern und vor allem auch diejenigen, die nicht zu Zeiten der 14-Zentimeter-Stummel unter den Brettern aufgewachsen sind und diese blind steuern können, hatten mit den modernen Finnen um die 20 Zentimeter echte Probleme. Sie klagten über das Gefühl, in einer ungewohnt aufrechten Position surfen zu müssen: „Ich kriege gar keinen Druck auf die Finne“, klagte Robbi, der mit der alten, breiteren 25er-Finne super zurechtkommt. Mit der neuen 21er wurde er auch im Laufe des Tages nicht warm. Auch hier können ein paar Zentimeter sehr viel ausmachen. Wer nicht gerade am geslideten Flaka 720 oder Double Spock arbeitet, hat mit etwas längeren Finnen keinen bedeutenden Nachteil.
Tipp: Bei Kontrollproblemen auf kurzen Freestyleboards zunächst einfach mal eine längere (eventuell alte) Freestyle-Finne um die 25 Zentimeter ausprobieren, bevor das Board an sich als untauglich abgeschrieben wird.
Die aktuellen Freestyleboards im Vergleich
Nicht nur generationsübergreifend konnten wir Unterschiede herausarbeiten. Es stellte sich schnell heraus, dass wir unter den aktuellen Boards zwei etwas bravere und zwei etwas quirligere im Gepäck hatten. Die Unterschiede sind hier vergleichsweise fein, aber dennoch relevant: Während sich die meisten erfahrenen Freestyler unter den Testern auf Goya und JP sofort wohl und sicher fühlten, waren es die noch kürzeren, runder geschnittenen Boards von Starboard und We One, die ihnen mehr abverlangten: „Ich bin noch nie so ein extrem kurzes Board gefahren und brauchte ein paar Schläge, um mich damit vertraut zu machen“, meinte Nils, der den Starboard Ignite mit nur 210 Zentimeter Länge zum ersten Mal ausprobiert hat. „Als Power-Move-Neuling konnte ich damit aber besonders bei weniger Wind ausgesprochen einfach durch Moves wie den Burner rotieren.“ Dasselbe gilt für den nur vier Zentimeter längeren We One. Die etwas komfortabler zu fahrenden und auch zu halsenden Bretter von Goya und JP, die einen Hauch schmaler sind und die magische Grenze von 215 Zentimeter Länge überschreiten, benötigen ein kleines bisschen mehr Kraftaufwand – sie wollen (auch wenn sie es im Endeffekt ähnlich gut können) gefühlt nicht ungezähmt immer weiter titschen und wirbeln.

Typenempfehlung Freestyleboards
Junge Ein- und Aufsteiger
Für Duck Jibe und 360er interessierst du dich so wenig wie für die Mathe-Hausaufgaben, wenn sich draußen die Bäume biegen. Auf dem Wasser fährst du kaum geradeaus, schaust zu Lennart Neubauer und Co. auf und willst ins Rotieren kommen. Egal ob du noch an der Air Jibe oder dem Flaka feilst oder schon die ersten Culos übst, aus denen so schnell wie möglich doppelte werden sollen – schau dich nach den modernsten, kompaktesten Boards auf dem Markt um und lerne damit umzugehen. Alles andere würde deinen Fortschritt im progressiven Freestyle nur unnötig aufhalten.
Erwachsene, ambitionierte Freestyler
Freestyle ist deine Leidenschaft und die Disziplin, die du hauptsächlich ausübst. Power Moves stehen bei dir noch auf dem Zettel, aber nicht gerade der Double Burner und der Weltmeistertitel. Du suchst ein Brett, mit dem du in allen Bedingungen zurechtkommst. Auch wenn es mal ruppig wird, willst du noch solide und entspannt freestylen. Dann macht es für dich eventuell Sinn, dich zwar nach den modernsten, aber dabei etwas klassischer gehaltenen, längeren Modellen der aktuellen Generation umzuschauen.
Gelegenheitsfreestyler
Freestyle ist für dich nur eine Notlösung, wenn keine Wellen sind. Burner und Culo auseinanderzuhalten kann für dich problematisch werden, doch du hast auch mit Sliding-Manövern, Spinloops und Shakas (die du vom Waven kannst) auf Flachwasser deinen Spaß. Einen Satz Freestylesegel anzuschaffen, lohnt sich für dich nicht – du nutzt immer deine Wavesegel, denn zum Ducken lernen fehlt dir die Flachwasserzeit. In diesem Fall wirst du mit einem mittellangen Youngtimer höchstwahrscheinlich genauso viel Spaß haben wie mit einem brandaktuellen Board – vielleicht sogar mehr.
Freeridestyler
Selbst Flaka und Shaka sind für dich Fremdwörter. In der Luft bist du selten zu finden, außer mal beim Chop Hop oder Spinloop. Du bist viel Grip von deinen Waveboards gewöhnt und nutzt gerne etwas längere Finnen. Freerideboards sind dir zu langweilig, Topspeeds haben dich noch nie interessiert, und du fährst ungern Segel über sechs Quadratmeter. Angleiten möchtest du entspannt ohne viel Körpereinsatz, trotzdem bist du eher der verspielte Surfertyp und möchtest durch 360er oder die ein oder andere Monkey Jibe gleiten. Dabei bieten dir Freestyleboards durch ihre breite Standfläche um den Mastfuß und die angenehme Volumenverteilung im Vergleich zu Freemove-/Freewaveboards mehr Sicherheit. Die langen Oldies könnten dir in diesem Fall tatsächlich mehr Spaß bereiten als alles andere.

Julian Wiemar
Redakteur surf