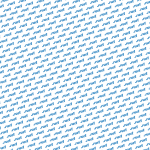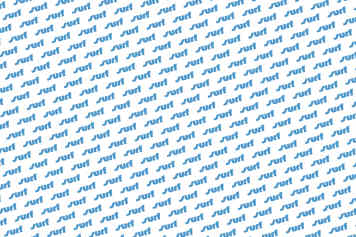Test Waveboards 2025: Allround-Waveboard gegen radikales Modell - fünf Paare im Vergleich
Surf Testteam
· 26.11.2024






- Allrounder oder Performance-Waveboard – das sind die Unterschiede
- Radikal oder Alleskönner – diese Brettgrößen machen Sinn
- Welches Wave-Level hast Du?
- Waveboard-Typ und -Größe - die surf-Empfehlung
- Duotone Grip 3 95 vs Grip 4 99
- Goya Custom Thruster 82 vs Custom Quad 88
- JP-Australia Magic Wave 89 vs Ultimate Wave 93
- Naish Global Quad 75 vs Hookipa Quad 84
- Severne Pyro 87 vs Nano Pro 92
- Alle Waveboards 2025 im Einzeltest
Dass aus einem Gespräch mit einem Leser oder einer Leserin eine Idee für einen zukünftigen Test entsteht, kommt öfter vor – auch bei diesem Thema war das so. Konkret ging es um die Frage, „welche Waveboardgröße eigentlich für ein bestimmtes Gewicht Sinn macht, wenn man seinen persönlichen Fuhrpark mit einem oder zwei Boards ausstatten möchte“.
Bei genauerer Betrachtung ist die Antwort darauf gar nicht so einfach, gibt es doch von den meisten Marken zwei Waveboard-Modelle: Die „Allrounder“ sollen ausgewogene Dreheigenschaften bieten, dabei aber in typischen Euro-Wavebedingungen mit Strömung und schräg auflandigem Wind noch gut gleiten und leicht zu kontrollieren sein. Dem gegenüber stehen die „Performance“-Boards, welche maximale Drehfreudigkeit und Radikalität versprechen, wofür auch etwas Gleitpower und Massentauglichkeit geopfert wird – so zumindest die Theorie.
Die Antwort auf die Frage: „Welche Waveboardgröße macht Sinn?“ sollte man also immer vor dem Hintergrund des jeweiligen Boardkonzepts betrachten. Konkret: Ist es besser, statt eines Allrounders mit 85 Litern eventuell ein Performance-Waveboard mit 92 Litern zu surfen, weil dieses vergleichbar gut gleitet und dreht – und obendrein zum Dümpeln mehr Sicherheit bietet? Oder bedeutet „kleiner“ auch immer „radikaler“?
Um Antworten darauf zu finden, haben wir zehn der neuesten Waveboards in Größen von 75 bis 99 Litern bestellt. Wir haben die Allrounder dabei immer etwas kleiner gewählt als das vermeintlich radikalere Konzept derselben Marke und dabei schließlich folgende Pärchen miteinander verglichen:
Allrounder oder Performance-Waveboard – das sind die Unterschiede
Im Durchschnitt fallen die Performance-Waveboards, abgesehen vom Nano Pro von Severne, etwas länger aus als die Allrounder. Markanter sind allerdings die Unterschiede bei den Outlines: Typische Allrounder wie der Duotone Grip 3, Naish Global Quad, Goya Custom Thruster oder der JP Magic Wave haben eine eher parallele Outline, will heißen: Bug- und Heckbereiche sind hier etwas breiter designt, was eine parallelere Kantenform ergibt und die Bretter kontrolliert carven lassen soll. Zudem sollen die breiteren Hecks mehr Kippstabilität und Speedhalten im Turn bieten.
Die Performance-Pendants Duotone Grip 4, Naish Hookipa Quad, Goya Custom Quad oder der JP Ultimate Wave sind stärker verrundet, haben also schmale Heck-und Bugbereiche. Zudem haben diese im Kantenbereich durchschnittlich mehr Kurve im Unterwasserschiff, um die Dreheigenschaften zu unterstützen.
Einige Details der Waveboards






- Noch mehr Details findet ihr in den Einzeltests oder in unserer Preview
Radikal oder Alleskönner – diese Brettgrößen machen Sinn
Wir haben alle Boards mit mehreren Testern gesurft, die zwischen 74 und 92 Kilo auf die Waage bringen. Zusätzlich haben wir die kleinsten Boards von einer leichten Gasttesterin fahren lassen. Ziel war es, herauszufinden, wo sinnvolle Volumenbereiche enden.
Schnell wurde klar: Die passende Brettgröße lässt sich nicht in eine einzige Formel pressen, sondern hängt stark vom Fahrkönnen ab. Unsere Tester sowie Gasttesterin Diana Lohoff, die alle ein hohes Niveau in der Welle haben, würden privat ausnahmslos drehfreudige Performance-Shapes, diese dann im Zweifel aber eine Nummer größer wählen. Im direkten Vergleich der Boardmodelle zeigte sich nämlich, dass die Dreheigenschaften stark vom Shape und weniger von der Größe abhängen. Selbst angepowert mit dem 4,0er Segel am Nordsee-Spot Rømø griffen unsere 80‐Kilo-Tester dann lieber zum Performance-Waveboard mit 93 Litern als zum 87er Allrounder, weil man mit den radikalen Vertretern, entsprechende Angleittechnik vorausgesetzt, vergleichbar früh ins Rutschen kommt, dabei aber leichter drehen kann und die „gefühlte“ Größe tatsächlich geringer ist. Diana kam mit einem Performance-Waveboard wie dem Naish Hookipa Quad 84 deutlich besser klar als mit einem 75er Allrounder: „Ich war überrascht, wie leichtfüßig ich das größere Board noch drehen konnte, selbst mit einem 3,3er Segel. Die gefühlte Größe war geringer als beim 75er Global Quad, der etwas gemäßigter abgestimmt ist.“
Die gleitstarken Allround-Waveboards sind, die persönlichen Präferenzen der Tester mal außen vor, aber keinesfalls überflüssig – auch das zeigte unser Test. Denn wer seltener in der Brandungswelle surft, profitiert von diesem Bretttyp ungemein: Die breiteren Hecks halten in Verbindung mit flacherer Bodenkurve den Speed auch vor moderaten Wellen besser, wodurch man dann oft mit mehr Speed an der Wellenlippe ankommt – und Speed ist eben die Grundvoraussetzung für einen guten Cutback. Auch zum Springen sind die Allround-Shapes oft besser geeignet, da sie im Mittel druckvoller beschleunigen, mehr Höhe laufen und Weißwasser leichter queren. Das Ergebnis: Man surft mehr Wellen, bekommt mehr Jumps – und hat am Ende mehr Spaß.
Das sagen die surf-Tester:
- “7 bis 8 Liter über meinem Körpergewicht, das ist für mich die obere Grenze, mit der ich maximal früh angleiten und das Board trotzdem noch eng drehen kann.” (Klaus Twilling)
- “Weniger Volumen = mehr Agilität – diese Formel gilt bei Waveboards weniger als bei anderen Brettklassen.” (Fabian Grundmann
- “Ein radikaleres Konzept eine Nummer größer zu wählen, diese Strategie macht oft Sinn.” (Marius Gugg)
- “Ich war überrascht, wie gut Boards drehen, von denen ich dachte, sie wären mir viel zu groß.” (Gast-Testerin Diana Lohoff)
- “Wie drehfreudig ein Board ist, hängt weniger vom Volumen als vor allem vom Shape ab.” (Manuel Vogel)
Welches Wave-Level hast Du?
Um den passenden Boardtyp und die richtige Größe zu finden, ordne dich nun einem der drei „Wave-Level“ zu, die konkrete Empfehlung für Brettvolumen und Boardtyp entnimmst du dann der Tabelle.
Level 1
Du lernst das Surfen in der Brandung erst oder hast infolge mangelnder Gelegenheiten nur selten die Chance, in richtigen Brandungswellen zu surfen? Auch Tage ohne brechende Welle, also bei Flachwasser- oder Bump ‐&-Jump-Bedingungen, gehören für dich dazu? Du möchtest keine drehfaule Gurke surfen, sondern durchaus Springen und das Abreiten nach Lee üben – aber eben mit Kontrolle? Dann benötigst du ein Board, welches mühelos gleitet, gut Höhe läuft, leicht übers Weißwasser floatet, gut springt und dich beim Abreiten sicher und ohne vorschnell einzuparken durch den Bottom Turn trägt. Die genaue Größenempfehlung findest du in der Tabelle.
Level 2
Dein Fokus liegt klar auf dem Surfen in der Welle, Tage im Flachwasser sind bei dir eher die Ausnahme? Du hast an guten Ostseetagen genauso deinen Spaß wie in krachenden Nordseebedingungen? Wellenritte nach Lee gelingen dir meist ohne größere Probleme und auf dem Weg nach draußen hältst du Ausschau nach Rampen für saftige Sprünge und erste Loops? Dann sind sowohl Allroundals auch Performance-Shapes prinzipiell geeignet – die passenden Größen entnimmst du der Tabelle.
Level 3
Dein Waveboard kommt zu 100 Prozent in der Brandung zum Einsatz, für Flachwasserbedingungen hast du ein anderes Board? Du nimmst gute Wavetage auf der Ostsee genauso mit wie kernige Nordseewellen und Trips an internationale Topspots? Du reitest problemlos nach Lee ab, carvst deine Bottom Turns mit Speed und Vorlage über den vorderen Fuß und hast Loops genauso im Repertoire wie radikale Cutbacks und erste Wavemoves wie Takas, Lipslides oder sogar 360s? Dann darfst du dich, ohne mit der Wimper zu zucken, dem Wave-Level 3 zuordnen – deine Boardempfehlung findest du in der Tabelle.
Waveboard-Typ und -Größe - die surf-Empfehlung
Wave-Level 1
Ein-Board-Lösung
- Board 1: Allround, Volumen: Körpergewicht +5 bis 8 Liter
Zwei-Board-Lösung
- Board 1: Allround, Volumen: Körpergewicht +0 bis 3 Liter
- Board 2: Allround, Volumen: Körpergewicht +8 bis 10 Liter
Wave-Level 2
Ein-Board-Lösung
- Board 1: Allround, Volumen: Körpergewicht +3 bis 5 Liter
- Alternative: Performance, Volumen: Körpergewicht +5 bis 10 Liter
Zwei-Board-Lösung
- Board 1: Performance, Volumen: Körpergewicht +3 bis 5 Liter
- Board 2: Allround, Volumen: Körpergewicht +8 bis 10 Liter
Wave-Level 3
Ein-Board-Lösung
- Board 1: Performance, Volumen: Körpergewicht +0 bis 5 Liter
Zwei-Board-Lösung
- Board 1: Performance, Volumen: Körpergewicht +/- 2 Liter
- Board 2: Performance, Volumen: Körpergewicht +5 bis 8 Liter
Zusätzlich zur Empfehlung von Board-Typ und -Größe findest du im Folgenden den Vergleich der getesteten Board-Pärchen. Detaillierte Einzelbeschreibungen aller Modelle und die technischen Daten gibt’s zusätzlich in den Einzeltests!
Duotone Grip 3 95 vs Grip 4 99

An Land
Das Duell der Giganten, zumindest unter dem Aspekt des Volumens, tragen die beiden Duotone-Modelle aus. Abgesehen von der Finnenbestückung – der Grip 3 kommt als Thruster, der Grip 4 als Quad – zeigen sich auch bei diesem Pärchen die schon zuvor beschriebenen typischen Unterschiede: Der Grip 3 fällt etwas kürzer aus, Bug- und Heckpartien sind sichtbar breiter designt, was eine recht parallele Outline zur Folge hat. Verglichen damit hat der Grip 4 deutlich mehr Kurve im Bereich der Kanten. Beide Modelle sind mit bequemen und durchweg doppelt verschraubten Schlaufen bestückt, auch die Pads sind gut gepolstert und griffig.
Damit Gewicht eingespart wird, fällt die Mastspur kurz aus, trotzdem hat man noch genügend Spielraum für individuelles Tuning.
Auf dem Wasser
Der Grip 3 gleitet harmonisch und ohne fühlbare Gleitschwelle an. Bedingt durch das Thruster-Setup und das etwas breitere Heck kann man gut Druck auf die Finnen ausüben, um einen guten Winkel zum Wind zu fahren und das Board auf sprungtauglichen Topspeed zu beschleunigen. Auch voll angepowert gehört der Grip 3 aber nicht zu den Brettern, die ein quirlig-freies Fahrgefühl vermitteln, vielmehr vermittelt das Board mit seiner schienenartigen Wasserlage und bester Dämpfung absoluten Komfort. Absolut überzeugend ist auch der Kantengriff, egal ob man eine Halse auf die Dünungswelle oder mit Speed durch den Bottom Turn zieht, der Grip 3 bietet immer genug Halt und Kontrolle auf der Kante. Nimmt man den Speed etwas raus oder dreht die Radien eher über den hinteren Fuß, entlockt man dem Board auch wirklich gute Dreheigenschaften, mit denen sich moderate Brandungswellen fachgerecht zerlegen lassen. Zudem hält der Grip 3 den Speed in mäßigen Wavebedingungen richtig gut, wodurch man immer mit genügend Speed an der Wellenlippe ankommen kann. Erst wenn die Wellen druckvoll oder der Wind stark werden, wird es zunehmend schwieriger, den Radius von weit nach eng zu verändern, um die Wellenlippe vertikal zu treffen. Geübte Waverinnen und Waver werden etwas Potenzial für radikale Cutbacks und Wavemoves vermissen.
Auch der Grip 4 überzeugt im Angleitduell absolut. Aufgrund der im Vergleich zum Grip 3 kürzeren Finnen und des schmaleren Hecks muss man beim Angleiten und Höhe laufen etwas feinfühliger belasten, der Grip 4 kommt insgesamt aber ähnlich früh auf Touren, präsentiert sich ebenfalls als sehr laufruhig und einfach zu fahren. Kabbelwellen zieht der fehlerverzeihende Shape schnell den Zahn. Wer glaubt, Waveboards mit knapp 100 Litern Volumen lassen sich nicht eng drehen, sollte mal den Grip 4 fahren – smooth und mit vergleichsweise wenig Kantendruck lässt dich das Brett umkanten. Auch bei höherem Speed – also vor druckvollen Wellen oder bei stärkerem Wind – bleibt die gute Variabilität bei Turns über den vorderen Fuß erhalten. Mit viel Dampf über die ganze Kante durch den Bottom Turn ziehen, um dann eng und senkrecht hoch zur brechenden Lippe zu steuern – das gelingt mit dem Grip 4 99 jederzeit. Dadurch bietet das Brett versierten Piloten spürbar mehr Potenzial für enge Cutbacks, Slides und Wavemanöver wie 360s und Takas.
Duotone Waveboards – das Fazit
Beide Boards sind gute Gleiter und punkten mit viel Kontrolle über einen großen Windbereich. Wer überwiegend in moderaten Brandungsbedingungen windsurft, aber auch regelmäßig an bei Bump‐&-Jump-Bedingungen aufs Wasser geht, fährt mit dem Grip 3 besser. Mit Vorlage über den vorderen Fuß zu carven, das gelingt mit dem Grip 4 deutlich besser. Dieser ist auch in großen Größen variabler und radikaler, ohne dabei zu fordernd zu sein – ein paar zusätzliche Liter Volumen stören bei diesem Modell absolut nicht.
Goya Custom Thruster 82 vs Custom Quad 88

An Land
Komplett neu designt geht das Goya-Pärchen ins Rennen. Verbaut werden US-Boxen, die Finnen fixiert man mit einem FCS-Schlüssel. Beim Custom Thruster sind die Finnen an den Spitzen leicht eingekerbt, was sich positiv auf das Twistverhalten und letztlich den Grip auswirken soll. Die weichen und bequemen Schlaufen verschraubt Goya hinten doppelt, vorne wird nur mit einer Schraube fixiert. Bezüglich der Outline unterscheiden sich die Bretter nur gering, die Maße sind nahezu identisch. Auch das Unterwasserschiff ist bei beiden Modellen von einer leichten Monokonkave im hinteren Bereich geprägt, die im Bereich der Schlaufen dann in ein leichtes V mit Doppelkonkaven übergeht. Auffällig gering fallen die Gewichte aus: Der Custom Quad 88 bringt es auf 6,05 Kilo, der Custom Thruster 82 knackt mit 5,92 Kilo sogar die 6-Kilo-Schallmauer.
Auf dem Wasser
Der neue Custom Thruster flutscht mit dem ersten Dichtholen mühelos über die Gleitschwelle, das Brett macht einen quirligen, schnellen Eindruck. Angepowert hängt es einerseits leicht und agil am Fuß, bietet andererseits aber noch genügend Kontrolle und Dämpfung, um auch in ruppigen Bedingungen unterwegs zu sein. Das quirlige Grundgefühl findet sich eins zu eins auch auf der Welle wieder: Egal ob man kurze, schnelle Haken über den hinteren Fuß fährt oder weite Radien mit viel Vorlage carvt, der Custom Thruster 82 macht alles bereitwillig mit. Er lässt sich mühelos ankanten, zieht mit guter Geschwindigkeit über die Kante und bleibt auch vor druckvollen Wellen erstaunlich variabel, sodass man die Radien gut variieren kann.
Ähnlich hörte es sich auch an, wenn unsere Testcrew im Anschluss an eine Session auf den Custom Quad 88 zu sprechen kam. Bezüglich der Angleitleistung lässt sich bei beiden Testmodellen quasi kein Unterschied ausmachen, lediglich die Gleitlage ist mehr „Quad-like“, das Brett sitzt also etwas satter im Wasser, gleitet nicht ganz so frei, sondern einen Tick mehr wie auf Schienen. Allroundqualitäten zeigt aber auch der Quad auf der Welle, hier lassen sich kurze Haken an kleinen Schaumwalzen ebenso zelebrieren wie schnelle, kraftvoll gecarvte Turns vor masthohen Brechern. Unterm Strich bietet der Quad noch einen Tick mehr Variabilität, vor allem vor dem Hintergrund, dass der getestete Thruster ja eine Nummer kleiner ist. Verglichen mit dem Vorgängermodell wirkt der Quad nun auch über den hinteren Fuß deutlich drehfreudiger und bietet dadurch auch für moderate Brandung und kurze Haken in hüfthohen Ostseewellen spürbar mehr Potenzial.
Goya Waveboards – das Fazit
So ähnlich die Shapes an Land, so ähnlich auch die Performance auf dem Wasser. Beide Modelle decken dank guter Gleitleistung, ausgewogenen Dreheigenschaften und viel Kontrolle einen großen Einsatzbereich ab. Wer überwiegend typische Euro-Wavebedingungen von Heiligenhafen bis nach Hanstholm surft, kann seine Entscheidung davon anhängig machen, ob man lieber das spritzigere Gleitgefühl und die noch druckvollere Beschleunigung des Thrusters haben möchte oder ob man stattdessen die etwas sattere Wasserlage des Custom Quad präferiert. Der Thruster bietet bei Bump & Jump und Leichtwind ein wenig mehr Potenzial, der Quad carvt in dicken Ozeanwellen trotz einiger Liter mehr auf den Rippen noch etwas ruhiger auf der Kante.
JP-Australia Magic Wave 89 vs Ultimate Wave 93

An Land
Der Ultimate Wave fällt im direkten Vergleich der JP-Modelle rund drei Zentimeter länger aus, hat aber, aufgrund seiner schmaleren Bug- und Heckpartien, eine rundere Outline. Der Ultimate wird ohne Finnen ausgeliefert, unsere Empfehlung sind Centerfinnen mit 14,5 bis 15 und Sidefins mit 9 bis 10 Zentimetern Länge. Das Board wird in einer leichten S-Tec-Konstruktion gefertigt und ist mit dünnen Pads ausgestattet. Positiv ist zu erwähnen, dass beide Modelle mit sehr guten Schlaufen versehen sind, die zudem durchweg doppelt und mit dicken Schrauben befestigt werden.
Auf dem Wasser
Die Magie des Magic Wave entfaltet sich gleich beim ersten Dichtholen: Das Modell zieht ohne Mühe los, erreicht einen sehr guten Topspeed und vereint das spritzige Fahrgefühl mit überzeugender Kontrolle. Selbst richtig angepowert mit dem 4,0er Segel und bei ruppigen Bedingungen schluckt der Magic Wave die Kabbelwellen stoisch weg und sorgt dafür, dass man mit Vollspeed auf die Suche nach der ersten Rampe gehen kann. Smooth gelingen Halsen gegen die Dünungswelle, beim Abreiten punktet das Brett schließlich mit viel Kontrolle auf der Kante. Am liebsten mag es mittlere und weite Radien, durch die der Magic Wave mit viel Kantengriff zieht. Auch das Potenzial, die Geschwindigkeit vor drucklosen Wellen und mit wenig Segelzug noch zu halten, ist überdurchschnittlich ausgeprägt. Bei typischen Sideonshore-Bedingungen – also wenn der Speed auf der Welle normalerweise nicht so hoch ist – entlockt man dem Board auch enge Snaps und ein Maß an Drehfreudigkeit, welches auch versierte Waverider zufriedenstellt. Bei Side- oder Sideoffshorewind und von kleinen Segeln befeuert wirken die Radien allerdings etwas limitiert, sobald man mit viel Vorlage und Geschwindigkeit über die Kante carvt – dann schlägt die Stunde des Ultimate Wave.
Der Ultimate Wave wurde auf dem Papier deutlich radikaler abgestimmt, ist aber – das merkt man auf dem Wasser sofort – keine lahme Wave-Banane. Verglichen mit dem Magic Wave kippelt er im Dümpeln etwas mehr und man muss ihn beim Angleiten etwas feinfühliger belasten, dann kommt das Board aber wirklich gut vom Fleck. Die Gleitlage wirkt nicht ganz so „sportlich-frei“ wie beim Stallbruder, sondern vermittelt jenes schienenartige Gefühl, welches man Quads gemeinhin zuschreibt. Dass der Ultimate beim Thema Drehfreudigkeit in einer völlig anderen Liga spielt, wird nicht nur bei der ersten Halse, sondern natürlich vor allem beim Wellenabreiten deutlich. Das Board lässt sich hier bereits mit spürbar weniger Druck ankanten und beherrscht alle Radien. Den Bottom Turn lang und mit viel Vorlage übers Rail carven und dann eng und vertikal zur Wellenlippe hochziehen – kaum ein Board ist hierbei so in seinem Element wie der Ultimate Wave. Auch mit dem 3,7er Segel befeuert bleiben die Radien überraschend variabel. Nur bei schlappen Wavebedingungen erfordert der Shape auch etwas mehr Fahrkönnen, um den Speed durch den Bottom Turn hoch zur Wellenlippe zu bringen.
JP-Australia Waveboards – das Fazit
Die beiden JP-Boards bedienen auf dem Wasser durchaus unterschiedliche Zielgruppen. Der Magic Wave fühlt sich im Vergleich etwas größer an – Gleitperformance und Speedniveau sind top, die Dreheigenschaften einem Waveboard für Nord- und Ostsee durchaus angemessen. Wer nicht unbedingt auf jeden Liter Volumen angewiesen ist, kann den Magic Wave im Zweifel eine Nummer kleiner wählen.
Der Ultimate Wave ist längst nicht mehr so selektiv wie früher und eröffnet seine überragende Drehfreudigkeit nicht nur Semi-Pros. Wer Bump-&-Jump-Tage sowieso auslässt, sicher nach Lee abreitet und ein variabel drehendes Board nur für die Welle sucht, kann bedenkenlos zum Ultimate Wave greifen. Weil Drehpotenzial und Kontrolle so überzeugend sind, stören beim Ultimate Wave auch ein paar zusätzliche Liter Volumen nicht – das Brett kann im Zweifel durchaus eine Nummer größer gewählt werden.
Naish Global Quad 75 vs Hookipa Quad 84

An Land
Die kleinsten Boards der Testgruppe gehen beide als Quad-Fins an den Start, unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Shapes allerdings stark. Das radikalere Performance-Modell Hookipa Quad ist rund vier Zentimeter länger, erscheint aber aufgrund seiner auffällig schmalen Bug- und Heckpartien in punkto Outline trotzdem deutlich stärker verrundet als der Allrounder Global Quad. Beide Boards überzeugen mit guter Ausstattung. So werden die bequemen Schlaufen durchweg doppelt verschraubt, und die Gewichte sind mit 5,87 Kilo (Global) und 5,98 Kilo (Hookipa) erfreulich gering. Die Pads sind griffig und vergleichsweise groß sowie dick dimensioniert.
Beim Unterwasserschiff haben die Designer dem Global einen moderaten Tailrocker und ein deutliches V (angedeuteter Kiel) mit Doppelkonkaven verpasst. Der Hookipa hat sichtbar mehr Aufbiegung im Heckbereich, ein in diesem Bereich deutlich stärker gewölbtes Deck und ist im Unterwasserschiff durchweg monokonkav gehalten.
Auf dem Wasser
Die fehlenden Liter merkt man dem Global Quad wirklich nur beim Dümpeln an, ansonsten liegt das Board ausgewogen im Wasser und setzt Böen gut in Gleitleistung um. Auch angepowert zieht der Global kontrolliert seine Bahnen und vermittelt ein schienenartiges Gefühl, was es auch weniger geübten Pilotinnen und Piloten leicht macht, den Chop zu bändigen oder die erste Rampe für einen Sprung zu nutzen. Sehr kontrolliert steht das Board auf der Kante, wenn man beispielsweise gegen eine Dünungswelle halst, und auch das Potenzial, den Speed in der Kurve zu halten, ist unverkennbar vorhanden. Beim Wellenabreiten zieht der Global mit viel Griff durch den Bottom Turn, liebt dabei aber vor allem mittlere und weite Radien – hier fällt es auch leicht, mit viel Speed oben an der Wellenlippe anzukommen. Der Naish-Allrounder dreht beim Cutback solide, so richtig enge Haken wollen mit dem Konzept jedoch nicht gelingen. Für enge Snaps, Takas oder gar 360s fehlt – trotz des geringen Volumens – etwas Drehpotenzial.
Wechselt man auf den nominell neun Liter größeren Hookipa Quad 84, wähnt man sich sofort auf einem kleineren Board. Durch das domige Deck kippelt das Brett stärker. Erfreulicherweise kommt auch der Hookipa Quad gut auf Touren, beschleunigt druckvoll, läuft auf der Geraden nur etwas looser und weniger schienenartig als der Global. Eine erste Halse gegen die Dünung deutet das Drehpotenzial des Boards bereits an, der Hookipa schnalzt auf dem Bierdeckel in die neue Richtung. Im Bottom Turn gelingen die Radien dann spürbar variabler, der 84er Hookipa dreht tatsächlich deutlich leichtfüßiger und enger als der kleinere Global. Allerdings will das Performance-Modell auch mit etwas mehr Können auf der Kante stabilisiert und mit Vorlage in den Turn gesteuert werden, damit er den Speed gut mit zur Wellenlippe hochbringt.
Naish Waveboards – das Fazit
Global Quad und Hookipa Quad sind sehr unterschiedlich. Wer sicher nach Lee abreitet, ein quirliges, drehfreudiges Modell für enge Turns sucht und ausschließlich in Brandungswellen surft, kann den Hookipa Quad wählen – idealerweise eine Nummer größer.
Der Global punktet vor allem mit sehr guten Gleit- und Kontrolleigenschaften und ist beim Wellenabreiten fehlerverzeihender und einfacher zu carven. Für Wave-Fans, die wechselweise im Ostsee-Chop und in gemäßigten Brandungswellen unterwegs sind, ist der Global eine gute Wahl – im Zweifel kann man das Board eine Nummer kleiner wählen.
Severne Pyro 87 vs Nano Pro 92

An Land
Der Pyro ist schon beinahe ein Klassiker und geht mit unverändertem Shape in die neue Saison, lediglich ein neues Finnen-Setup wurde dem Brett verpasst. Verbaut sind fünf Boxen, sodass man das Board auch als Thruster fahren kann. Der Nano Pro 92 hingegen ist rein als Quad designt und fällt sogar geringfügig kürzer aus als der Pyro. Zudem offenbart der Nano Pro im breiten Swallowtail einen markanten Channel und überdurchschnittlich viel Tailrocker, der Pyro ist im Heckbereich deutlich flacher geshapt.
Auch bei der Ausstattung unterscheiden sich die Modelle: Beim Pyro ist zumindest die hintere Schlaufe doppelt verschraubt. Beim Nano Pro ist dies nicht der Fall, und auch das hintere Footpad fällt schon arg kurz aus, sodass man mit großen Füßen auch mal auf der Kante des Pads landet.
Im Unterwasserschiff wurde dem Pyro ein Monokonkave verpasst, während der Nano Pro von einem durchgehenden V, also einem angedeuteten Kiel, von vorne nach hinten gekennzeichnet ist. Mit 6,22 Kilo (Pyro) und 5,82 Kilo (Nano Pro) fallen die Boards ebenfalls ansprechend leicht aus.
Auf dem Wasser
Der Pyro hat in den letzten Jahren immer ein Feuerwerk abgebrannt, wenn es um das Thema Gleiten ging. Wie sollte es angesichts des unveränderten Shapes auch sein.
Dabei bleibt es auch 2025. Das neue Finnen -Setup erzeugt allerdings gefühlt einen Tick mehr Fahrwiderstand als gewohnt. Trotzdem kommt der Pyro in Summe hervorragend auf Touren, angepowert läuft das Board kontrolliert und wie auf Schienen durch ruppigste Bedingungen. Auch beim Wellenabreiten punktet das Brett mit toller Kontrolle auf dem Rail, hier kann man sich hirnlos in den Bottom Turn schmeißen, ohne Angst haben zu müssen, dass das Board verkantet oder gar zickig wird. Dabei liegen dem Shape mittlere Radien, die mit viel Speed gecarvt werden, am besten. Ganz eng dreht der Pyro nur mit richtig viel Druck, lockere Snaps aus dem Fußgelenk schüttelt man mit dem Pyro jedenfalls nicht.
Aber kann der Nano hier mehr? Wenn es ums reine Drehen geht, ist die Antwort eindeutig „Ja“. Es dürfte auch am starken V im Unterwasserschiff liegen, dass sich der Nano Pro leichter rail-to-rail umkanten lässt. Enge Radien über den hinteren Fuß gelingen mit dem Board leichtfüßiger, und das, obwohl es einige Liter mehr auf den Rippen hat. Andererseits will das Brett im Bottom Turn aber auch mit mehr Können geführt werden, denn die großartigen Carving-Eigenschaften des Pyro erreicht es nicht ganz. Und noch bei einer anderen Disziplin kann der Nano nicht mit seinem Stallbruder mithalten: Gleiten! Zwar kommt das Board passabel auf Touren, vor allem im unteren Windbereich vermisst man aber spürbar Beschleunigung und Speed. Unserer Meinung nach ist dafür der Heckshape verantwortlich, denn die markanten Channels erzeugen beim Gleiten ein fühlbares und auch sichtbares Sprudeln und dementsprechend etwas Fahrwiderstand. Dies ist auch der Grund, weshalb dem Board beim Abreiten druckloser Wellen oder mit wenig Segelzug befeuert etwas schneller die Puste ausgeht.
Severne Waveboards – das Fazit
Für den Nano Pro entscheidet man sich, wenn man auf gehobenem Level in der Welle unterwegs ist und regelmäßig in druckvollen Wellen oder zumindest gut angepowert surft. Dann kann der Shape seine Stärken – smoothes und variables Drehen – voll ausspielen, sogar wenn man das Modell eine Nummer größer wählt. Der Pyro hat eine deutlich größere Zielgruppe – starkes Angleiten, überzeugende Kontrolle und 1-a-Carvingeigenschaften sind gute Trümpfe für eine Vielzahl von Spots. Weil der Pyro aber nicht die radikalsten Dreheigenschaften bietet, kann man das Modell im Zweifel gerne mal eine Nummer kleiner fahren.