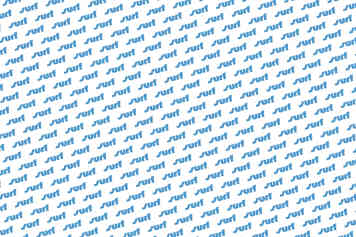Masten
Wer kein neues Komplettrigg mit den vom Hersteller empfohlenen Komponenten aus dem gleichen Haus kauft, muss gezwungenermaßen etwas tiefer in die Mast-Materie einsteigen, um den passenden Mast für sein Segel zu finden. Hier wird man mit einer Vielzahl von Daten und Zahlen konfrontiert. Was für den Kauf wichtig ist – und was du getrost wieder vergessen kannst, erfährst du hier.
RDM/SDM
RDM (Reduced Diameter Masts) sind die modernen Masten mit reduziertem Durchmesser, auch als „skinny“ bezeichnet. Im Vergleich zu ihren dickeren Vorgängern, den SDM (Standard Diameter Masts), machen sie Segel deutlich handlicher und benutzerfreundlicher. Dank ihrer dickeren Wandstärke sind RDM-Masten zudem stabiler und widerstandsfähiger gegen Bruch. Etwa 2004/2005 wurden RDMs eingeführt. Trotzdem haben sich SDM-Masten weiterhin bewährt, insbesondere wegen ihrer höheren Steifigkeit, die bei großen Segeln über 6,5 qm und im leistungsstarken Regattabereich von Vorteil ist.
Auf dem Gebrauchtmarkt findet man immer noch kürzere SDM-Masten aus früheren Zeiten, die für kleinere Segel gedacht waren. Diese passen jedoch kaum noch in moderne Segel und sind deshalb so gut wie nicht mehr gefragt. „Ich habe zum Beispiel lange keinen 430er SDM mehr verkauft“, sagt surf-Tester Frank Lewisch, der sich durch seine Arbeit im Shop gut auskennt. Zur Orientierung: Segel zwischen 3,3 qm und 6,5 qm, mit Mastlängen zwischen 340 und 430 cm, werden fast ausschließlich auf RDM-Masten geriggt. Segel von 7,0 qm bis 9,6 qm, mit Mastlängen von 460 bis 490 cm, benötigen oft den dickeren SDM. Im Übergangsbereich, insbesondere bei Freeride- und Freeracesegeln, können beide Masttypen geeignet sein. Hier sollte unbedingt die Empfehlung des Herstellers berücksichtigt werden.
Weitere Windsurf Basics:
Mastlänge
Die Länge muss stimmen. Der englische Begriff Luff bezeichnet die Länge des Vorlieks und ist in der Regel auf dem Segel aufgedruckt. Der Mast, den ihr kaufen wollt, sollte irgendwie mit dieser Luff- bzw. Vorlieklänge übereinstimmen. „Irgendwie“ deshalb, weil man einen gewissen Spielraum hat. Masten gibt es in Längenabstufungen von 30 Zentimetern (340 cm, 370 cm, 400 cm usw.). Da man zum Aufriggen immer eine Masterverlängerung benötigt, kann jede Zwischenlänge eingestellt werden. Laut unserer Erfahrung sollte man Masten jedoch nicht mehr als maximal 40 Zentimeter verlängern, da das Segel sonst spürbar weich wird und schlechter funktioniert. Bei einer Vorlieklänge von beispielsweise 440 Zentimetern ist es also empfehlenswert, einen 430er Mast um zehn Zentimeter zu verlängern statt einen 400er um 40 Zentimeter! Zu lang darf der Mast lediglich sein, wenn das Segel ein Variotopp (verstellbares Gurtband am Segeltopp) hat, durch das er oben überstehen kann – dieser darf dann bis zu 20 Zentimeter länger sein als die angegebene Vorlieklänge. Bei Vorlieklängen von beispielsweise 432 Zentimetern stehen oft auch zwei Mastlängen zur Option: ein 400er mit 32 Zentimetern oder ein 430er mit nur zwei Zentimetern Verlängerung. Zwei Dinge sollten deine Kaufentscheidung hier beeinflussen. Erstens: Längere Masten sind immer härter. Je härter der Mast, desto straffer fühlt sich auch das Segel an. Für schwere Fahrer (> 95 Kilo) kann dies ein Vorteil sein, in den Händen leichter Surfer (< 65 Kilo) zieht sich aufgrund des harten Masts dann oft das nötige Profil nicht mehr ins Segel – ein kürzerer Mast wäre in diesem Fall besser geeignet. Zweitens: Wie passt der Mast zu deiner restlichen Segelpalette? Hast du ohnehin nur kleinere Segel, kannst du dir den langen Mast unter Umständen komplett sparen. Planst du noch größere Segel dazuzukaufen, wirst du ihn früher oder später brauchen.
IMCS-Wert
Der IMCS-Wert (IMCS = Indexed Mast Check System) ist ein Relikt aus der Vergangenheit und bezüglich seiner Aussagekraft sehr begrenzt. Er gibt die Masthärte an – je geringer der Wert, desto weicher der Mast. Da es innerhalb ein und derselben Mastlänge aber keine Härteunterschiede gibt (so haben zum Beispiel alle 400er-Masten die Härte 19, alle 430er-Masten die Härte 21 usw.), muss man über diesen Wert eigentlich gar nicht nachdenken.
Carbon-Gehalt
Je höher der Carbon-Anteil, desto hochwertiger, aber auch teurer ist ein Mast. Ein Mast aus 100 Prozent Carbon ist besonders leicht, muss jedoch sehr vorsichtig behandelt werden, da schon kleine Beschädigungen zum Bruch führen können, wenn der Mast belastet wird. Daher sollte man sorgfältig überlegen, was genau man benötigt und was man bereit ist zu investieren. In der Praxis zeigen Masten mit einem niedrigen Carbon-Anteil beim Surfen, insbesondere in kabbeligem Wasser, eine eher träge Reaktion. Hochwertige Carbon-Masten hingegen kehren schneller in ihre Idealposition zurück, was das Segel leichter und reaktionsfreudiger erscheinen lässt und theoretisch die Geschwindigkeit des Surfers erhöht. In der Praxis ist jedoch meist das Fahrkönnen entscheidender. Ambitionierte Hobbysurfer finden in Masten mit 50 bis 80 Prozent Carbon-Anteil eine leistungsfähige und dennoch erschwingliche Option, bei der die Leistung und das Handling im Vergleich zu den teureren 100-Prozent-Carbon-Masten kaum beeinträchtigt sind. Für Einsteiger, die gerade mit den ersten Gleitversuchen beginnen, reicht ein kostengünstiger Mast mit einem Carbon-Anteil von 30 bis 50 Prozent völlig aus.
Für Hobbysurfer sind Masten mit 50 bis 80 Prozent Carbon eine ausreichend leistungsfähige Option.
Biegekurve
Wenn es um die Biegekurve von Masten geht und man unsicher ist, sollte man sich an einer wichtigen Regel orientieren: der goldenen Mitte. Denn die Biegekurve von Masten ist ein komplexes und oft diskutiertes Thema in der Windsurfwelt. Nicht ganz unschuldig daran sind die verschiedenen Segelfirmen, die alle ihr ganz eigenes Rezept einer gelungenen Kombination zwischen Mast und Segel verfolgen und zudem auch wollen, dass man möglichst nur Produkte von der eigenen Marke kombiniert. Je nachdem, wie sich der Mast biegt, ändert sich das Profil des Segels und verändert damit das gesamte Fahrverhalten.
Mit der Constant »Curve« geht man das geringste Risiko ein.
Manche Firmen schwören auf ein Flextop, bei dem die obere Hälfte des Mastes weicher ist und sich damit etwas mehr biegt als der Rest. Andere wiederum setzen auf die Constant Curve, die sich durch eine gleichmäßige runde Mastkurve auszeichnet. Ganz zuletzt gibt es da noch das Hardtop, bei dem der Mast im oberen Bereich besonders hart ist. Glücklicherweise sind in den letzten Jahren mehr und mehr Marken auf die goldene Mitte von Constant Curve umgesattelt, die für nahezu alle Marken und Modelle recht gut passt. Wenn ihr also einen Mast kauft, der nicht von der Marke eures Segels stammt, geht ihr mit einem Mast, der die Constant Curve hat, das geringste Fehlerrisiko ein.
Mast-Verlängerung & Mastfuß
Mastverlängerung und Mastfußplatte müssen kompatibel sein, damit sich Brett und Rigg später verbinden lassen. Glücklicherweise hat sich auf dem Markt großflächig das Pin-System durchgesetzt – 95 Prozent der Mastfüße haben einen dünnen Metallzapfen, der in die Verlängerung gesteckt wird, um Brett und Segel zu verbinden. Trotzdem gibt es alternative Systeme (z. B. Quick Release oder US-Cup), die nur in entsprechende Verlängerungen passen. Achtet also darauf, dass Mastfuß und Verlängerung vom gleichen System sind.
Ebenfalls kompatibel müssen Durchmesser der Verlängerung und des Mastes sein. Die Verlängerungen werden wie Masten als RDM (Reduced Diameter) und SDM (Standard Diameter) bezeichnet – die Bezeichnung von Mast und Verlängerung muss zwingend übereinstimmen, sonst ist die Verlängerung unbrauchbar.
Mastverlängerungen werden außerdem in unterschiedlichen Längen (z. B. 45 cm, 30 cm, 15 cm) angeboten. Je nach Bedarf macht die eine oder andere Sinn. Wer zum Beispiel insgesamt nur zwei Segel verwendet, die mit entsprechenden Masten beide nur wenige Zentimeter Verlängerung benötigen, kann darüber nachdenken, eine kürzere Verlängerung zu wählen, um sich das überflüssige Gewicht des oberen Verstellbereiches zu sparen. Hier geht es jedoch nur um ein paar Gramm, generell wird eine Verlängerung mit 30 Zentimetern Verstellbereich am häufigsten gebraucht. Und zuletzt kommt es auch hier zu der guten, alten Frage: Carbon oder Aluminium? Bei einem Gabelbaum wird der Großteil der Surfer den Unterschied zwischen Carbon und Aluminium schnell spüren – bei der Verlängerung eher nicht. Hier kann man beruhigt zur Aluminium-Version greifen. Eine Verlängerung aus Carbon ist lediglich sehr leicht, aber auch dementsprechend teuer, ohne dass man davon als Nicht-Profi spürbare Vorteile hätte.
Gabelbäume
Länge
Der Aufdruck „Boom“ auf dem Segel zeigt die erforderliche Länge des Gabelbaums an. Da Segel am Schothorn je nach Vorlieben und Windverhältnissen entweder bauchig oder straff getrimmt werden können, geben viele Hersteller die Gabelbaumlänge mit einer Toleranz von plus/minus zwei Zentimetern an. Bei der Auswahl des Gabelbaums sollte jedoch in Betracht gezogen werden, etwas mehr Spielraum einzuplanen, da die angegebenen Maße nicht immer exakt sind. Für das größte Segel ist es ratsam, mindestens fünf Zentimeter zusätzliche Länge einzuplanen. Wenn auf dem Segel „Boom 195 cm“ steht, sollte man beispielsweise einen Gabelbaum kaufen, der auf mindestens 200 Zentimeter ausgezogen werden kann.
Generell ist es vorteilhaft, mehr Spielraum zu haben, da ein weniger ausgezogenes Endstück den Gabelbaum stabiler macht, im Vergleich zu einem kürzeren Modell, das vollständig ausgefahren werden muss. Wird der Gabelbaum vollständig ausgezogen, besteht ein erhöhtes Risiko, dass er bei einem Sturz beschädigt wird. Ideal ist es, einen Gabelbaum zu wählen, der drei bis vier Segelgrößen abdeckt, sodass man nur einen Gabelbaum benötigt. Der Verstellbereich ist meist gut sichtbar auf den Holmen aufgedruckt.
Carbon-Gabelbäume bieten einige Vorteile, doch auch die Holme aus Aluminium können für viel Surfspaß sorgen.
RDM/SDM
Hier geht es um die Größe der Aussparung am Gabelbaumfrontstück zur Befestigung am Mast. Einige kleine, moderne Gabelbäume bis zu 200 Zentimetern Länge – für den Einsatzbereich Wave/Freestyle – sind heutzutage ausschließlich auf die dünnen RDM-Masten (Reduced Diameter) abgestimmt. Die Aussparung innerhalb der Klemme ist dann zu schmal, um den Gabelbaum an einem dicken SDM-Mast (Standard Diameter) zu befestigen. Die meisten anderen Gabelbäume (vor allem ab 200 Zentimetern aufwärts) für größere Segel sind in der Regel für beide Masttypen passend. Denn in der breiteren Aussparung am Frontstück ist einfach ein herausnehmbarer Adapter integriert, der die unterschiedlichen Durchmesser ausgleichen kann. Falls ihr einen Gabelbaum kauft, der solch einen Adapter nicht dabeihat, dann habt ihr die Möglichkeit, einen Universal-Adapter zu kaufen. Nicht selten wird dieser beim Kauf eines Skinny-Mastes auch schon mitgeliefert.
Carbon/Aluminium
Gabelbäume aus Carbon bieten zahlreiche Vorteile: Sie sind leichter, steifer und stabiler und haben oft einen kleineren Holmdurchmesser, wodurch sie angenehmer in der Hand liegen. Wenn der Preis keine Rolle spielt, wäre die Wahl klar: Carbon! Da der Gabelbaum die direkte Verbindung zum Segel darstellt, beeinflusst er maßgeblich, wie sich das Segel in der Hand anfühlt. Aluminium-Gabelbäume können zwar ebenfalls für viel Surfspaß sorgen und sind sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Surfer keine sofortige Einschränkung, dennoch kann man jedem uneingeschränkt empfehlen, zur Carbon-Gabel zu greifen, wenn es möglich ist. Besonders schwerere Surfer, wer viel springt oder solche, die mit leistungsstarken Cambersegeln unterwegs sind, sollten den steiferen Carbon-Holm ernsthaft in Betracht ziehen und nicht an der falschen Stelle sparen.