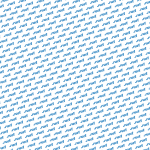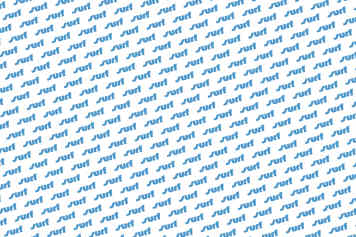Der Name Baptiste Cloarec fiel in den letzten Jahren immer mal wieder im World Cup. Sein Können blitze hier und da auf, aber in den Ergebnislisten krebst er eher auf den hinteren PLätzen herum. Spots wie Sylt und Pozo sind nicht unbedingt sein Ding. Groß geworden im surferischen Sinne – körperlich misst er nur 1,67 Meter – wurde er in der Bretagne. An einem Spot namens Le Dossen gibt es an guten Tagen Bedingungen, von denen Surfer in Pozo oder auf Sylt nur träumen können. Cleane, schnell laufende Wellen, bei schräg ablandigem Wind. Wer das nicht glauben kann sollte sich einmal auf Baptiste Cloarecs Youtube-Kanal den Clip Moghawaii II anschauen. Danach wundert man sich nicht mehr, warum er als No Name beim Wave World auf Fidschi die versammelte Weltelite geschlagen hat.
Wie würdest du dich selbst beschreiben?
Das weiß ich nicht so genau. Dass ich ein ... (er überlegt). Ich weiß nicht genau, wie ich mich persönlich beschreiben soll. Ich würde sagen, jemand, der hartnäckig, ausdauernd und bisweilen auch ein bisschen stur sein kann.
Und als Windsurfer, was ist dein Style?
Man könnte vielleicht sagen – energisch. Eigentlich bin ich ziemlich klein, nur 1,67 m groß und wiege 62 kg. Ich bin klein, aber verhältnismäßig schwer. Ich habe das gleiche Gewicht wie Thomas Traversa und Camille Juban, die deutlich größer sind. Ich habe also viel Power.
Welches Material hast du auf Fidschi benutzt?
Ich war mit einem RRD-Serienboard unterwegs. Ich habe hauptsächlich das Hardcore Wave mit 70 Litern benutzt. Als Segel hatte ich hauptsächlich Seriensegel aber auch einige Prototypen dabei.
Surfst du nur mit Serienmaterial?
Nein, nein, ich habe auch einige Prototypen. Aufgrund meiner Größe muss ich kleine Bretter benutzen und da sie bei RRD keine Bretter unter 74 Liter mehr herstellen – das 70l, das ich benutzt habe, ist ein altes Brett – musste ich mir in Italien bei Francisco Pizzocolo im RRD Shaping Room Customs anfertigen lassen. Bei den Segeln habe ich auch einige Prototypen, denn im Vergleich zu meiner Körpergröße muss ich die Gabelbaumöse etwas tiefer anbringen, um das Segel im Bottomturn leichter ablegen zu können. Damit fühle ich mich einfach wohler.

Cloudbreak ist sehr speziell. Wie hast du dich darauf eingestellt?
Ich hatte keine besondere Vorbereitung. Aber der Spot, an dem ich hier in Frankreichsurfe, in Le Dossen, ist dem Spot auf Fidschi sehr ähnlich ist. Es gibt hier zwar keine Steine, also sind die Wellen etwas weniger kräftig und leichter zu fahren. Aber Side-off, Backbord und kräftige Wellen, das sind Bedingungen, die ich mag.
Was waren die größten Herausforderungen für dich?
Die Boote, die uns zum Spot brachten. Man musste sehr gut organisiert sein, da die Boote klein waren. Wir teilten uns zu viert ein Boot, jeder mit zwei Brettern und mehreren Segeln. Es war ziemlich kompliziert, da das ganze Material übereinander lag und man im Boot mit dem Wellengang aufriggen musste. Dann natürlich die Welle selbst. Sie ist superschnell, sodass man ein gutes Timing haben muss. Man darf keine Zeit verlieren und muss konzentriert sein, denn wenn man zu weit geradeaus fährt, ist es vorbei, man steckt in den Steinen fest und braucht eine halbe Stunde, um wieder herauszukommen.
Wie fühlt es sich an, Erster zu werden, vor Fahrern wie Brawzinho, Victor, Ricardo...?
Das ist verrückt, ich realisiere das noch garn nicht so richtig. Eigentlich weiß ich gar nicht so recht, was ich hier mache. Aber ich bin so glücklich und außerdem haben sie mir alle gratuliert, das ist so cool.

Wer sind deine Vorbilder?
Ich weiß es nicht. Ich habe nicht viele feste Vorbilder. Ich schaue mir viele Videos von allen an. Ob sie nun PWA-Champions sind, wie Brawzinho oder aus der Tour ausgestiegen sind, wie Boujmaa, Jaeger... Ich schaue mir alle ihre Videos an und dabei lerne ich eine Menge. Aber ich könnte nicht einen speziellen Fahrer als Vorbild nennen.
Cloudbreak hat große Wellen aber wenig Wind. Warst du an diese Art von Bedingungen gewöhnt?
Gewohnt würde ich nicht sagen, aber ich surfe auch sehr viel ohne Segel. Ich denke, das hilft. Das sind Bedingungen, die man auch hier in der Bretagne vorfindet. Die Wellen sind nicht so groß und nicht so stark, aber was den Wind und die Windrichtung angeht, ist es ein bisschen ähnlich. Und die Geschwindigkeit der Welle ist das Gleiche. In Le Dossen läuft sie hyperschnell.
Wie war der Tagesablauf auf Fidschi, wie lange warst du auf dem Wasser?
Wir hatten insgesamt drei Wettkampftage. Oft gab es bis zum Mittag keinen Wind und man brauchte eine Stunde mit dem Boot, um vom Hotel aus zur Welle zu gelangen. Für den Katamaran der Organisation brauchte man zweieinhalb Stunden. Wir hatten also nur kleine Zeiträume von vier bis fünf Stunden für den Wettkampf. Die Zeit auf dem Wasser war nicht sehr lang. Wir kamen erst kurz vor dem Start am Spot an und bevor der Wettkampf begann, gingen alle noch mal aufs Wasser, um sich aufzuwärmen und ein paar Wellen zur Eingewöhnung zu reiten. Aber mit 30 Ridern im Wasser bekommst du in Cloudbreak maximal eine oder zwei Wellen zum Aufwärmen, nicht mehr. Daher verbrachten wir nicht sehr viel Zeit auf dem Wasser.
Wie liefen die Heats und die Bewertung ab?
Wir hatten Heats von 28 Minuten und das war nicht schlecht. Einmal wollte die Orga auf 23 Minuten runtergehen, weil sie dachten, dass wir sonst nicht genug Zeit hätten, um den Wettkampf zu beenden, aber wir waren uns alle einig, dass es besser war, die Heats etwas länger zu halten, weil die Wellen in großen Abständen kamen. Am Ende des Heats werteten die Judges deine zwei besten Wellen. Die Bewertung hing stark davon ab, ob du dich in der kritischen Zone der Welle oder mehr auf der Schulter befandest, ob du Aerials springen würdest oder nicht und ob du sie am Anfang oder am Ende der Welle machst, da es einige Stellen gab, die technisch sehr schwierig waren. Es gab ziemlich viele Kriterien...

Gibt es einen Moment, der dir bei diesem Wettkampf besonders in Erinnerung geblieben ist?
Kurz vor meinem Halbfinale wurde ich von einer Welle auf die Korallen gedrückt. Ehrlich gesagt, ist das eine meiner schlimmsten Erinnerungen. Das war wirklich beängstigend. Ich habe alles zertrümmert und hatte auch Angst um mich selbst, weil ich auf den Grund des Wassers wurde wurde, das war gruselig.
Was hältst du vom IWT/PWA-Zusammenschluss?
Ich persönlich, als junger Mensch, finde es großartig. Man fährt zu magischen Spots wie Chile, Fidschi, Peru... Das sind alles unglaubliche Plätze und es muss Windsurfszenen an diesen Orten geben. Klar, die PWA-Tour ist insofern interessant, als es sich um die größeren Events handelt, mit mehr Budget, also mehr Medien und besseren Organisationen. Aber es sind immer die gleichen Spots und es sind immer die gleichen Leute, die dort die besten Leistungen abliefern. Für einen Festlands-Europäer ist es fast unmöglich, etwas auf der PWA-Tour zu erreichen, es sei denn, du wohnst auf den Kanaren oder auf Hawaii und surfst jeden Tag an dem Spot, an dem der Wettbewerb stattfindet. Diejenigen, die am Spot wohnen, sind sehr privilegiert. Wenn man also die beiden Touren mischt, gibt es viele neue Spots, an denen niemand wohnt, und das macht es fairer.
Wolltest du dieses Jahr die gesamte Tour machen?
Mein Ziel für dieses Jahr war es, die Etappen zu machen, von denen ich immer geträumt habe – Chile, Fidschi und Peru. Aber letztendlich werde ich angesichts meiner guten Platzierung trotzdem auf die Kanarischen Inseln fahren, um zu sehen, wie es dort läuft, und was danach kommt, werden wir je nach meiner Platzierung nach dem Sommer sehen.
Du bist, glaube ich, ein junger Offizier der Handelsmarine. Wie kommst du mit dieser doppelten Tätigkeit zurecht?
Es stimmt, dass ich eine Handelsmarineschule besucht habe. Ich habe meine Schülerzeit beendet und mache die praktische Ausbildung, die zwölf Monate dauert. Ich habe noch sechs davon vor mir. Ich bin bei Brittany Ferries, das ist eine bretonische Reederei, die zwischen der Bretagne, England, Irland und Spanien verkehrt, angestellt. Die sind wirklich supercool. Sie arrangieren es wirklich gut, dass ich zu den Wettkämpfen fahren kann. Und wenn ich dann nach Hause komme, surfe ich für sie. Das ist mit Abstand die beste Lösung, den ich finden konnte, und ich liebe, was ich tue.
Wolltest du schon immer Profi-Windsurfer werden oder ist das mehr eine Leidenschaft?
Ich weiß nicht, ob ich mich als Profi bezeichnen würde, da ich ja immer noch einen Offiziersjob habe. Ich wollte nie wirklich Profi werden, aber trotz allem habe ich das Gefühl, dass ich es immer mehr werde, weil es langsam gut läuft. Und es macht Spaß, es ist ein bisschen das gute Leben, nur zu surfen, an wunderschönen Orten, zu reisen. Das ist wirklich sehr cool.