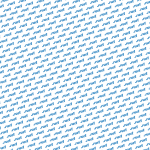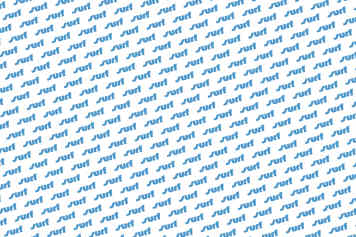Trans Atlantic Windsurf Race 1998: “Es war eigentlich unmöglich. Aber wir haben es geschafft.” - Louie Hubbard über das Atlantik-Rennen und sein Buch
Tobias Frauen
· 20.06.2025
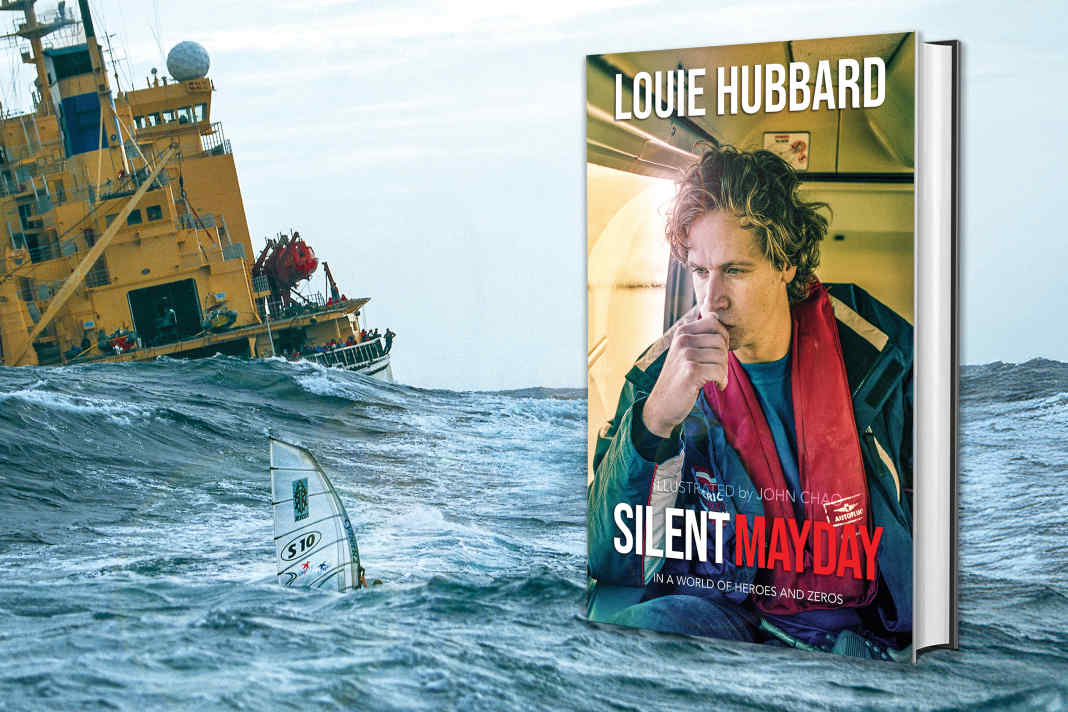





Im Jahr 1998 machten sich einige der besten Windsurfer auf den Weg zu einem Rennen quer über den Atlantik – von Neufundland bis nach Großbritannien. Louie Hubbard war der Mann hinter dem Trans Atlantic Windsurf Race, das sich als sehr bedeutender Teil seines Lebens herausstellen sollte. Nun hat Hubbard – der in den späten 90ern auch Tourmanager der PWA war – seine Geschichte aufgeschrieben: In „Silent Mayday“ berichtet er nicht nur ausführlich von den vier Jahren Vorbereitung des Rennens und acht Tagen auf dem Wasser, sondern auch davon, wie er mit einer lebensbedrohlichen Erfahrung und persönlichen Traumata umging.
Dein Buch „Silent Mayday“ sollte ursprünglich nicht unbedingt vom Trans Atlantic Windsurf Race handeln – es gab persönliche Dinge, über die Du schreiben musstest, und daraus entstand das Buch.
Ja, das trifft es ziemlich genau. Vor ein paar Jahren wurde mir klar, dass ich über einen bestimmten Abschnitt meines Lebens sprechen musste. Die Atlantikrennen stehen genau im Zentrum davon. Ich musste loswerden, was ich vor diesen Rennen erlebt hatte – einiges davon war ziemlich traumatisch – und auch über das, was ich danach tat und nie wirklich akzeptieren konnte. Aus all dem heraus ist letztlich das Trans Atlantic Windsurf Race entstanden.
Was das Schreiben Jahre später wirklich ausgelöst hat, war mein Sohn. Er war 18 und klang ein bisschen wie ich damals. Und ich dachte: „Ich habe über all das nie gesprochen.“ Ich konnte nicht länger unehrlich sein. Ich schrieb es auf, gab es meiner Frau und sagte: „Das ist passiert. Das war mein Leben.“ Alle, die es gelesen haben meinten, ich soll es veröffentlichen. Ich weiß nichts über die Publikation von Büchern, aber zum Glück kennt sich John Chao damit aus – er hat das Magazin “American Windsurfer” gemacht und war 1998 Teil des Rennens. Er hat Hunderte von Stunden in das Projekt investiert – komplett unbezahlt, aus Liebe zum Sport und um die Geschichte zu erzählen.
Untergang auf dem Atlantik
Das traumatische Erlebnis war, mitten im Atlantik mit einem Segelboot zu sinken, richtig?
Ja. 1993 war ich ein sehr junger Segler, ich war gerade 21 geworden. Ich war damals bereits seit etwa zwei Jahren Skipper – und zwar nicht auf einem kleinen Boot. Es war ein 60-Fuß-Schiff, rund 20 Meter lang – was damals etwa dem heutigen 100-Fuß-Standard entsprach. Nur Millionäre hatten solche Boote. Ich hatte früh mein Yachtmaster-Zertifikat gemacht, einen tollen Auftrag und ein großartiges Boot bekommen – ich liebte das Leben. Wir waren auf dem Rückweg über den Atlantik – dieselbe Route wie beim späteren Windsurf-Rennen. Es war meine dritte Überfahrt, ich war also kein Neuling. Aber wir gerieten in einen Sturm der Stärke 10, er kostete mehrere Schiffe und Menschenleben. Der Bug unseres Bootes wurde aufgerissen, und wir erlebten einen sieben- bis achtstündigen Überlebenskampf, der damit endete, dass wir in ein Rettungsfloß mussten und schließlich von einem anderen Schiff gerettet wurden.
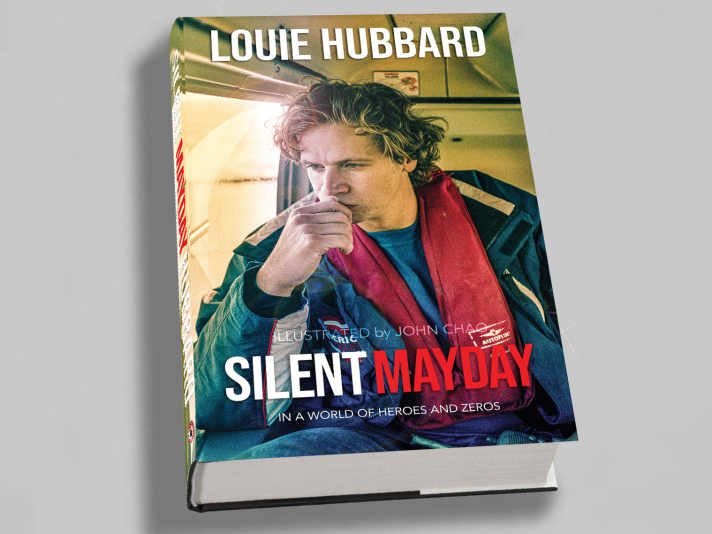
Nach der Rettung haben wir nie wirklich darüber gesprochen. 1993 war man der Meinung, der beste Weg, so etwas zu verarbeiten, sei einfach, es zu vergessen. Weiterzumachen. Aber die Geschichte, wie wir sanken und gerettet wurden – das ist eine bemerkenswerte Geschichte, wirklich mitreißend zu lesen. Ich habe aber nicht sofort darüber geschrieben. Erst kamen andere Teile des Buchs dran, aber ich wusste, dass ich zu dem Sturm zurückkehren müsste. Und als ich das tat, waren die Leute gebannt. Sie konnten nicht aufhören zu lesen – nicht nur über das, was uns draußen widerfuhr, sondern auch über das, was zu Hause geschah. Wir waren in den Schlagzeilen – alle großen britischen Fernsehsender und Zeitungen berichteten. An Land herrschte echte Panik.
Und dieses Erlebnis, dieses Trauma, führte zur Idee eines Windsurf-Rennens über den Atlantik…
Genau. Als ich zurückkam – immer noch erst 21 – begann ich innerhalb eines Jahres mit der Planung einer Solo-Windsurf-Überquerung des Atlantiks. Und tatsächlich hab ich es zweimal versucht. Kaum jemand weiß das. Vielleicht haben ein paar Leute einzelne Artikel in kanadischen oder britischen Zeitungen gesehen – ich habe einige dieser Artikel inzwischen wiedergefunden. Weniger als ein Jahr nach dem Untergang startete ich von Neufundland zu einem Solo-Versuch. Teile der Vorbereitung waren unglaublich gut gemacht – andere eher katastrophal. Aber ich war furchtlos. Ich dachte damals nicht groß darüber nach, aber im Rückblick war das genau der Punkt. Ich dachte: „Ich habe einen Sturm der Stärke 10 überlebt. Ich kann alles schaffen.“ Ich war voller Adrenalin und habe wahrscheinlich überschätzt, was ich leisten konnte.
Ich war voller Adrenalin und habe wahrscheinlich überschätzt, was ich leisten konnte.”
Und genau hier schlägt das Buch die Brücke zu Trauma und mentaler Gesundheit. Das Jahr war unglaublich hart. Ich scheiterte mit meinem Solo-Versuch. Ich war vom jungen Kapitän, der Luxusyachten segelte, gut verdiente und den Atlantik überlebt hatte, zu einem Typen geworden, der etwas Verrücktes versuchte und scheiterte. Ich hatte all mein Geld ausgegeben. Ich saß allein in Kanada und dachte: „Was zum Teufel mach ich jetzt?“ Das war die Geburtsstunde des Trans Atlantic Windsurf Race.
Du hast die gescheiterten Solo-Überquerungen also verdrängt?
Absolut. Ich war überzeugt – und vielleicht hatte ich sogar recht – dass, wenn die Leute davon wüssten, sie mir nicht zutrauen würden, so etwas wie das Rennen zu organisieren. Also tat ich so, als wäre es nie passiert. Und das ist hart. Besonders, als ich dann recht schnell aufstieg. Ich wurde ziemlich zügig PWA-Tourmanager, begann das Rennen zu organisieren. Ich wurde eine öffentliche Figur in der Windsurf-Welt. Und die ganze Zeit über hatte ich Angst, dass jemand die Wahrheit herausfinden könnte. Das Buch handelt also sehr stark von dieser Dualität: dem äußeren Erfolg und der innerlich nervösen, verletzten Person, die versucht, alles zusammenzuhalten und nicht enttarnt zu werden.
Du führst eine Crowdfunding-Kampagne für das Buch durch, um auf solche Traumata aufmerksam zu machen.
Ja, genau. Ich dachte: Wenn ich das veröffentliche, soll es auch etwas Gutes bewirken. Also haben John und ich einen Plan ausgearbeitet. Wir haben genug Geld gesammelt, um tausend zusätzliche Exemplare zu drucken. Wenn wir also in den Druck gehen, drucken wir so viele, wie bestellt wurden – plus tausend mehr. Diese gehen an Wohltätigkeitsorganisationen. Wir hoffen, damit 30.000 oder 40.000 Pfund für Trauma- und psychische Gesundheitsprojekte zu sammeln.
Richtest du das Buch eher an die Windsurf-Community oder an ein breiteres Publikum?
Ich denke, man muss bei seinem Kernpublikum anfangen – bei den Leuten, die dabei waren oder davon gehört haben. Also ja, die Windsurf- und Segelwelt. Neil Pryde zum Beispiel hat es gelesen – und er war begeistert. Aber ich hoffe, es geht darüber hinaus. Nicht nur alte Windsurfer. Der Windsurf-Markt heute ist ganz anders – manche Leute wissen nicht einmal, dass Robby Naish Windsurfer war! Aber ja, wir starten beim Kern und sehen, wohin es sich entwickelt.
Aus der PBA wurde die PWA - und Louie Hubbard wurde Tourmanager
Was ist deine Verbindung zum Windsurfen? Bist du früher auch Regatten gefahren?
Nein, ich habe nie ernsthaft an Wettbewerben teilgenommen. Ich war bei ein paar Amateurveranstaltungen dabei – nichts Professionelles. Die einzigen Rennen, bei denen ich je mitgemacht habe, fanden in England statt, auf den Hayling Islands. Für mich war Windsurfen ein reines Freizeitvergnügen. Ich habe es geliebt, aber ich habe es nie als Karriereweg gesehen. Segeln hingegen erschien mir beruflich machbarer. Also bin ich diesen Weg gegangen und ziemlich früh eingestiegen. Als ich später geschäftlich zum Windsurfen kam, ging es darum, die Rennen zu organisieren. So habe ich die Leute aus der Szene kennengelernt.
Interessanterweise stieg ich genau in dem Moment ein, als die PWA gegründet wurde – direkt nachdem die PBA zusammengebrochen war. Meine ersten echten Kontakte hatte ich noch zur PBA und Christian Herles. Aber dann brach alles irgendwie zusammen. Eine Zeit lang war es chaotisch. Und daraus wurde die PWA geboren.
Und wurdest du sofort PWA-Tourmanager?
Nicht sofort, aber es ging schnell. Ich kam zuerst mit Cliff Webb in Kontakt, der damals die TV-Berichterstattung für die PBA produzierte (und auch heute für den Livestream verantwortlich ist, Anm. d. Red.). Cliff stellte mich ein paar Leuten vor – Christian Herles von der PBA und Stuart Sawyer, der zu dem Zeitpunkt ein paar Topfahrer managte. Über das nächste Jahr blieb ich mit ihnen in Kontakt, während ich das Atlantikrennen konzipierte. Was lustig ist: Hinter den Kulissen begann schon alles auseinanderzubrechen – aber ich wusste das nicht. In diesem allerersten Treffen mit Christian Herles war er begeistert von meiner Idee. Er sagte, sie sei brillant, er hätte Sponsoren parat, und wir fingen sofort an, über Zahlen zu reden. Ich ging raus und dachte: „Das ist es – ich hab’s geschafft.“ Zwei Wochen später brach die ganze PBA zusammen, und ich ging vom Höhenflug direkt ins Chaos.
Ich ging vom Höhenflug direkt ins Chaos.”
Ich war dann zufällig auf den Kanaren, als die PWA ihre ersten echten Events veranstaltete – Gran Canaria, Fuerteventura, Teneriffa. Die Organisation war ein Albtraum. Es war eine neue Struktur, und Tour- und Eventmanager kamen damit nicht klar. Einer von ihnen kündigte ein paar Tage nach Tourbeginn. Als ich zurück nach England flog, saß Stuart Sawyer zufällig im selben Flugzeug, und wir kamen ins Gespräch. Er kannte mich und mein Projekt inzwischen ein wenig, und irgendwann sagte er einfach: „Was wäre, wenn du Tourmanager wirst? Könntest du das gleichzeitig machen?“. Als dann der Event auf Sylt stattfand, war ich Tourmanager. Cliff spielte dabei eine zentrale Rolle – ihm verdanke ich eine Menge.
Wie lange warst du Tourmanager der PWA?
Fünf Jahre. Damals fühlte sich das wie eine Ewigkeit an. Aber dann kam Rich Page, der bis zur letzten Saison geblieben ist. Das war eine verdammt lange Zeit.
Mehr Abenteuer als Wettkampf - So lief das Trans Atlantic Windsurf Race
Zurück zum Trans Atlantic Windsurf Race – kannst du es für Leute, die es nicht kennen, kurz zusammenfassen?
Es war ein Windsurf-Rennen über den Atlantik, von Kanada nach England. Aber um das möglich zu machen, brauchten wir Teams statt Einzelpersonen – niemand hätte das alleine schaffen können. Also war es um nationale Teams herum aufgebaut. Es war auch sehr viel Logistik: notwendig: Begleitboote, medizinische Versorgung, Essen, Unterkünfte. Deswegen hatten wir den russische Eisbrecher „Kapitan Khlebnikov“ als Mutterschiff, auf dem alle schlafen und essen konnten und die Fäden zusammenliefen. Außerdem brauchten wir kleinere RIBs (Schlauchboote) für direkten Support und sogar einen Hubschrauber für Luftbilder und Notfälle. Nach und nach wurde das zu einer riesigen schwimmenden Operation – alles, um ein transatlantisches Windsurf-Rennen möglich zu machen.
Was war wichtiger – das Abenteuer oder der Wettkampf?
Am Anfang ging es nur um den Wettbewerb. Ich wollte die besten 20 Profis da draußen sehen, im Vollgasrennen über den Atlantik. Aber die Logistik war so herausfordernd – vor allem finanziell – dass wir den Fokus verlagern mussten. Also entwickelte sich das Ganze schrittweise. Das Rennen wurde mehr zu einem Abenteuer, zu einer gemeinsamen Leistung. Wenn die Leute heute zurückblicken, ist es genau das, woran sie sich erinnern. Nicht nur der Wettbewerb – sondern die Tatsache, dass wir es tatsächlich geschafft haben.
Das Rennen wurde mehr zu einem Abenteuer, zu einer gemeinsamen Leistung.”
Denkst du manchmal zurück und fragst dich: „Haben wir das wirklich gemacht?“ Gerade wenn du an die Gefahren denkst?
Die ganze Zeit. Und ich frage mich: Ist das einfach das Alter, das da spricht? Heute denke ich: „Würde ich wirklich noch einmal so eine Verantwortung übernehmen wollen?“ Damals habe ich das nicht so empfunden. Ich fühlte mich unbesiegbar. So ist das eben – große Expeditionen werden oft von Leuten in ihren Zwanzigern angeführt, von Menschen mit mehr Mut als Vorsicht. Ja, es gab Risiken. Vom RIB aufs Mutterschiff zu steigen bei hohem Seegang – das anzusehen, lässt mir heute einen Schauer über den Rücken laufen. Aber wir hatten gute Leute. Die RIB-Fahrer waren Profis. Wenn jemand ins Wasser fiel, war er in Sekunden wieder draußen. Aber trotzdem… Ich würde es nicht noch einmal machen. Ich bin froh, dass ich es gemacht habe – aber einmal reicht.

Erinnerst du dich an die Zahlen? Wie viele Leute waren beteiligt, wie lange dauerte es, wie weit sind sie gewindsurft?
Es waren etwa 70 Leute involviert, das Ganze dauerte acht Tage. Ich glaube, wir haben ungefähr ein Drittel bis die Hälfte der tatsächlichen Strecke windsurfend zurückgelegt – weil wir nachts aus Sicherheits- und Logistikgründen mit dem Motor gefahren sind. Ursprünglich hatten wir mehr Zeit eingeplant, aber zwei Wochen vor dem Start verloren wir einen wichtigen Sponsor – 120.000 Dollar weg, was 1998 eine riesige Summe war. Also mussten wir alles verkürzen, Verträge neu verhandeln und mit dem arbeiten, was wir hatten.
Und wie habt ihr die Rennen gemacht?
Jedes Team hatte ein eigenes Begleitboot. Morgens formierten sich die RIBs zur Startlinie. Das Mutterschiff fuhr voraus. Von dessen oberstem Deck aus hatten wir ein riesiges Sichtfeld. Sobald die RIBs in Position waren, begann die Startsequenz – Flaggen, Countdown, das volle Programm. Ziel war es, das Mutterschiff einzuholen, es diente als Ziellinie. Manchmal absolvierten wir mehrere Etappen pro Tag, je nach Wind und Wetter. Teils war Strategie gefragt, teils Ausdauer, teils verrückte Improvisation. Es ist schön, heute zurückzublicken und zu sagen: „Verdammt nochmal – wir haben das wirklich gemacht.“
Teils war Strategie gefragt, teils Ausdauer, teils verrückte Improvisation.”
Wie hast du die Fahrer ausgewählt? Ging es einfach darum, wer dabei sein wollte, oder gab es ein strukturiertes Auswahlverfahren für die Teams?
Nein, am Ende stand das Rennen jedem offen, der in der Lage war, ein Team aufzustellen. Und ehrlich gesagt: Da begannen schon die ersten großen Herausforderungen. Zuerst wandte ich mich direkt an die Profis. Ich sprach mit Athleten, manche hatten Manager. Nehmen wir Björn Dunkerbeck – er wäre perfekt für sowas gewesen und hätte es geliebt. Aber er machte nichts ohne eine ordentliche Gage, und das konnten wir schlicht nicht stemmen. Also verfolgte ich ein Konzept, das man aus großen Segelrennen kennt: Wer 50.000 Pfund aufbringen konnte, hatte einen Startplatz für sein Team. Deshalb hatten wir am Ende diese Art von gemischten Teams aus Profis und Amateuren. Die Amerikaner zum Beispiel waren technisch gesehen Amateure, aber unglaublich talentiert. Eddy Patricelli, Jace Panebianco – das waren herausragende Windsurfer, nur eben keine Vollzeit-Profis. Das “American Windsurfer Magazine” stieg ein, half bei der Finanzierung. Dadurch wurde es möglich.
Apropos American Windsurfer – John Chao war auch dabei. Er hat dir auch beim Buch geholfen, oder? War das sozusagen der PR-Arm deiner Aktion?
Ja, irgendwie schon. Aber John war nicht einfach nur der Fotograf. Er war der Herausgeber des “American Windsurfer Magazine”. Als ich dann in Richtung Amateurteams umdachte, bin ich auf ihn zugegangen und habe gesagt: „Was ist mit einem amerikanischen Team?“ Und er war sofort dabei. Er hat das ganze Ding geleitet: das Team aufgebaut, für Öffentlichkeitsarbeit gesorgt, Logistik organisiert. Er war auch mit auf dem Mutterschiff dabei und hat dort fünf Jobs gleichzeitig gemacht, absolut unverzichtbar. Er war einzigartig, weil er einen ähnliches Mindset hatte wie ich: „Lass es uns einfach durchziehen.“ Kein endloses Nachdenken – einfach machen. So jemand ist selten. Als ich mit dem Schreiben des Buches begann, war es ein Instinkt, ihn zu kontaktieren. Er hat jedes Foto von damals. Und er war glücklich, dass die Bilder wieder Verwendung finden. Es hat sich alles irgendwie geschlossen.
Wie eine Kreditkarte das Rennen in letzter Sekunde rettete
Wenn du zurückblickst – was ist deine schönste Erinnerung an das Rennen – und was die schlimmste?
Der schönste Moment? Ganz klar: Als wir endlich grünes Licht bezüglich des Wetters bekamen und das Rennen unter diesen extremen Bedingungen tatsächlich stattfand. Es gab echte Zweifel, ob das überhaupt funktionieren würde. Nicht so sehr von den Windsurfern, aber vom Support-Team. Auf dem Schiff herrschte eine klare Hierarchie, und wir mussten vor allem die RIB-Fahrer überzeugen. Als wir die RIBs dann im Wasser hatten und hinterher die Reaktionen von Leuten wie Robert Teriitehau und Anders Bringdal hörten – „So etwas habe ich noch nie erlebt“ – da wusste man: Wir haben etwas Außergewöhnliches geschafft. Nicht nur ein Rennen. Es war ein Ereignis. Etwas Historisches. Dieser Moment war all den Stress und das zerstörte Equipment wert.
Wir haben etwas Außergewöhnliches geschafft. Nicht nur ein Rennen. Es war ein Ereignis. Etwas Historisches.”
Und das Schlimmste? Ehrlich gesagt: es war ein finanzieller Albtraum. In der Nacht vor dem Start wurde mir klar, dass ich mich heftig verrechnet hatte. Ich hatte mich verpflichtet, die Hafengebühren für das Mutterschiff zu übernehmen – und ging von einer Nacht aus. Das wären so 4.000–5.000 Dollar gewesen. Aber durch Verzögerungen lag das Schiff drei Nächte im Hafen, und dann kamen noch andere Kosten dazu. Als ich zum Hafenmeister ging, bekam ich die Rechnung: 12.000 Dollar. Das Schiff würde erst auslaufen, wenn die Zahlung eingegangen war. Am Ende rettete meine American-Express-Karte das Rennen. Damals hatte Amex kein Ausgabenlimit. Ich rief an, sagte, ich sei im Urlaub und müsse ein Boot für 8.000 Dollar chartern. Sie haben es freigegeben. Es war extrem stressig. Dieses Rennen war eigentlich unmöglich. Aber wir haben es geschafft.

Wenn du heutige Technik siehst – Drohnen, Social Media, Livestreams – denkst du dann manchmal: „Hätten wir das damals bloß gehabt“?
Oh, total. Hundertprozentig. Das Ganze ist jetzt 27 Jahre her, und trotzdem hat niemand je wieder etwas Ähnliches gemacht. Das hätte ich nie erwartet. Normalerweise werden Actionsportarten mit der Zeit extremer. Aber selbst heute blicken die Leute zurück auf unser Rennen und sagen: „Wow.“ Wenn man es heute machen würde – mit Drohnen, Livestreams vom Mutterschiff, Social-Media-Berichten an Bord – man könnte etwas Phänomenales erschaffen. Wenn ich es noch mal machen könnte, würde ich es sofort tun. Mit heutiger Technik würden die Leute zuschauen und sagen: „Oh mein Gott, hast du gesehen, was die da draußen machen?!“
Als du mit dem Schreiben des Buchs begonnen hast – kamen da all diese Erinnerungen plötzlich zurück? Oder hat dich das Trans Atlantic Windsurf Race die ganze Zeit begleitet?
Nicht bewusst, aber ich hatte mich von vielen Leuten von damals entfernt. Das Leben kam dazwischen – Kinder, Länderwechsel, andere Jobs. Aber durch das Buch bin ich mit so vielen wieder in Kontakt gekommen. Auch mit Leuten von vor dem Rennen – etwa denen, mit denen ich im Rettungsfloß war, als unser Boot sank. Oder aus der Zeit meines Solo-Versuchs später. Und jetzt, wo ich wieder auf sie zugegangen bin, sage ich: „Hey, erinnerst du dich noch damals? Hier ist, was wirklich hinter den Kulissen passiert ist.“ Die Reaktionen waren unglaublich. Das war der schönste Teil des ganzen Prozesses!
Vielen Dank für das Gespräch und viel Erfolg für das Buch!
Update Dezember 2025: Das Buch “Silent Mayday” kann inzwischen über diese Seite bestellt werden: silentmayday.org
Trans Atlantic Windsurf Race - die Dokumentation

Tobias Frauen
Redakteur